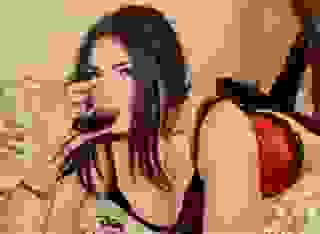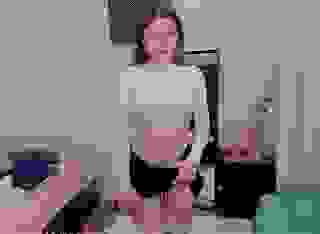Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hier„Ein wirklich schöner Ort, um seinen Kriegsdienst abzuleisten", fasste Georg Plater seine Eindrücke zusammen. „Hier herrscht eigentlich der perfekte Frieden."
„Und wir erkunden jetzt das Wetter, damit an anderem Ort erfolgreich Krieg geführt werden kann." Thomas nickte mehrfach nachdenklich vor sich hin. „Ist schon eine verrückte Welt." Dann klopfte er mit beiden Händen auf seine Oberschenkel. „Lass uns als erstes die Messgeräte aufstellen. Ich nehme sie dann in Betrieb und kalibriere alles. Du kannst dann erst einmal sehen, wie man den Herd und den Ofen anheizt. Wird sicherlich noch eine kühle Nacht."
„Einverstanden." Die Männer stellten ihre Becher beiseite und machten sich an die Arbeit.
Es war bereits später Nachmittag am Ende eines sehr langen Tages. Die Instrumente der Wetterstation waren aufgebaut, kalibriert und lieferten erste Messwerte zur Temperatur, zum Luftdruck, zur Luftfeuchtigkeit, zur Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Der Regenmesser war aufgebaut und wartete auf seinen ersten Einsatz. Zudem begann Obergefreiter Thomas Langlois mit seinem Tagesreport zur optischen Wetterbeobachtung, zur Wolkenausbildung. Der Kurzwellensender war aufgebaut und an die mit einem kleinen Windraddynamo wiederaufladbare Batterie angeschlossen. Für den Abend hatte Thomas die erste 10-Sekundenmeldung ihres zweimal täglichen Wetterberichts vorbereitet, die so schnell abgesendet werden konnte, dass der Sender nicht eingepeilt werden konnte. Georg und er waren so mit ihrer Arbeit beschäftigt, dass sie nicht mitbekamen, dass plötzlich eine schwarz gekleidete, junge Frau im Leuchtturmwärterhaus stand. Erst als die Frau sich räusperte, schreckten die beiden Männer zusammen und schauten sie mit großen Augen an.
„Bonjour", sagte die Frau mit ziemlich rauer Stimme, „das ist aber eine Überraschung. Wann sind Sie denn angekommen?"
Augenscheinlich war die junge Frau nicht über die Tatsache erstaunt, dass plötzlich im ehemaligen Leuchtturmwärter-Cottage Leben eingezogen war, sondern nur der Zeitpunkt hatte sie überrascht.
Georg Planter hatte sich als Erster gefasst, war aufgestanden und streckte seine Hand zur Begrüßung aus. „Hallo, ich bin Georges", stellte er sich kurz vor. Dann deutete er auf seinen Partner, der ebenfalls hinzutrat. „Und das ist Thomas. Man hat uns heute morgen hier am Strand abgesetzt und wir haben begonnen, uns einzurichten und funktionsfähig zu machen."
„Aha", antwortete die junge Frau, „Wir hatten sein eigentlich bereits früher erwartet. Das Gouverneursamt hatte uns einen Termin Anfang März genannt." Sie zuckte mit ihren Schultern. „Aber jetzt sind sie da." Sie nickte kurz und deutete einen Knicks an. „Ich bin Madeleine Montabon und kümmere mich mit meiner Mutter Geraldine Safrane und meinen Schwestern um den Leuchtturm und das funktionierende Leuchtfeuer." Sie zuckte wieder, diesmal etwas hilflos wirkend mit ihren Schultern. „Männer haben wir in unserer Familie keine mehr. Deshalb haben wir auch ihre Aufgaben übernommen."
„Das tut mir leid." Thomas Langlois hatte irgendwie instinktiv begriffen, dass der Verlust der Männer der Familie Safrane tragischen Hintergrund hatte. Dazu passte auch die vollständig schwarze Kleidung der jungen Frau.
„Wir haben sie alle in den letzten zwölf Monaten verloren; meinen Vater, meinen Mann und meinen Bruder. War wirklich ein schreckliches Jahr." Dann straffte sie sich. „Ich muss das Leuchtfeuer beim Start kontrollieren", erklärte sie. „Es schaltet sich morgens von allein aus, wenn es heller wird. Das spart viel Petroleum. Aber die automatische Startvorrichtung am Abend ist ziemlich unzuverlässig. Und deshalb geht jeden Abend jemand von meiner Familie hier heraus, um diesen Vorgang zu kontrollieren und gegebenenfalls von Hand auszuführen." Sie lachte leise. „Früher hat das mein Vater gemacht. Und jetzt bin ich meist dran." Mit diesen Worten verließ sie das Cottage, wenig später hörten die beiden Wettersoldaten die Tür zum Leuchtturm auf- und zugehen.
„Unsere Mission ist anscheinend tatsächlich richtig angekündigt und vorbereitet worden", staunte Georg. „Ich war da echt misstrauisch."
„Ich auch. Um so erfreulicher für uns. Wir haben einen Herd zum Kochen, einen Ofen zum Heizen, dazu zwei richtige Betten, auf denen wir unsere Schlafsäcke ausrollen können. Ich hatte mir, ehrlich gesagt, den ersten Abend auf Miquelon schlimmer vorgestellt." Er grinste seinen Kameraden schelmisch an. „Und jetzt taucht eine reine Frauenfamilie auf, die uns anscheinend auch noch betreut."
Georg lachte leise. „Hätte wirklich schlimmer kommen können. Anscheinend hat zumindest diese Madeleine keine Ahnung von unserer wirklichen Mission und hält uns tatsächlich für französische Meteorlogen."
Thomas nickte. „Und deshalb sollten wir ab sofort nur noch Französisch miteinander reden, damit uns nicht aus Versehen jemand entlarvt."
„Oui, Monsieur", antwortete Georg zustimmend und grinste erneut.
Wenige Minuten später stand Madeleine wieder im Cottage. „Braucht ihr noch irgendetwas? Ich kann Euch gerne morgen Nachmittag etwas mitbringen."
„Danke, im Moment sind wir erst einmal gut versorgt." Er lachte wieder leicht. „Am liebsten hätte ich jetzt einen Krug Bier. Wir haben so viel gearbeitet heute."
Madeleine lächelte ihn an. „Da müsst ihr bis morgen warten. Wir haben eine sehr kleine Brauerei im Ort. Und auch noch eine Destillerie. Die beiden anderen sind stillgelegt."
„Ihr brennt Schnaps hier?" Georg war fast fassungslos.
„Ja", antwortete Madeleine unschuldig. „Eigentlich haben uns die Destillerien und die Brauerei überhaupt erst richtig Geld nach Miquelon gebracht. War ein Riesengeschäft für unsere Familien während der amerikanischen Prohibition. Hier gebraut und gebrannt und dann mit unseren kleinen Fischkuttern nach Maine geschmuggelt. Die Amerikaner konnten gar nicht genug bekommen. Und haben sehr gut bezahlt. Ist leider deutlich zurückgegangen, nachdem die generelle Prohibition in Amerika vor acht Jahren aufgehoben wurde. Aber in den New England States gibt es nach wie vor Abnehmer für unseren Whisky und unseren Gin. Nur unser Bier brauen wir nur noch für uns selbst." Madeleine machte wieder einen leichten Knicks und drehte sich um, um nach Hause zu gehen.
„Wie lange brauchst Du für den Weg nach Miquelon?" fragte Thomas noch neugierig.
„Etwa eine Stunde für eine Strecke. Wenn ich jetzt losgehe, bin ich mit der letzten Dämmerung wieder zuhause."
Georg hatte auf dem tadellos funktionierenden Herd aus den mitgebrachten Vorräten eine schmackhafte Suppe gezaubert, die die beiden Männer mit Genuss löffelten.
„Madeleine ist eine wunderschöne Frau", bemerkte schließlich Thomas.
Georg nickte. „In der Tat. So jung und schon Witwe. Ob ihr Mann im Krieg gefallen ist? Hier ist ja alles friedlich."
„Bin gespannt, wie der Rest der Familie ist", sinnierte Thomas. „Immerhin haben wir bereits am ersten Tag örtlichen Familienanschluss gefunden."
„Und das anscheinend ohne Risiko, aufzufallen oder gar verraten zu werden." Georg nickte jetzt ebenfalls nachdenklich. „Davor hatte ich eigentlich am meisten Angst. Das wir hier ankommen und dann nach wenigen Tagen als Feinde entlarvt und zu Kriegsgefangenen gemacht zu werden." Er hob seinen mit frischem Wasser gefüllten Becher und stieß mit Thomas an. „Ein Hoch auf unsere Französischlehrer. Mit unserem Dialekt nimmt uns jeder unsere Herkunft aus Nordfrankreich ab."
„Wo kommen wir eigentlich her, wenn wir gefragt werden?"
Thomas dachte kurz nach. „Lothringen? Du aus Thionville, ist eine Hütten- und Stahlstadt wie Völklingen? Und ich aus Metz, das kenne ich gut."
„Einverstanden. Passt ganz gut, unsere Geburtsorte in unseren neuen französischen Papieren liegen auch im Nordosten."
Am nächsten Nachmittag kam Madeleine zusammen mit ihrer ebenfalls schwarz gekleideten Mutter zum Leuchtturm. Geraldine Safrane wirkte trotz ihrer schwarzen Trauerkleidung ungeheuer lebendig, ihre Augen funkelten geradezu vor Temperament, was sich auch in ihrer unglaublich schnellen Sprechweise ausdrückte. Ihr langes schwarzes Haar, das sie zu einem mächtigen Zopf zusammengebunden hatte, war mittlerweile mit vielen silbrig-grauen Strähnen durchzogen
„Die Herren lechzten gestern nach einem Krug Bier", grinste sie Georg und Thomas an und stellte eine Umhängetasche auf den Tisch. Sie griff in die Tasche und zauberte zwei zugepfropfte Keramikkrüge hervor. „Bitte sehr. Direkt aus unserer Dorfbrauerei, heute morgen ganz frisch abgefüllt."
Georg war begeistert. „Was für eine wunderbare Überraschung. Ich hatte bei unserer Stationierungsanweisung bereits befürchtet, dass wir für die Dauer unseres Aufenthaltes zu Abstinenzlern werden würden."
Mutter wie Tochter lachten laut auf. „Miquelon ist in den letzten zweiundzwanzig Jahren durch Bier und Schnaps reich geworden. Während die Puritaner in Amerika die reine Lehre verkündeten, haben wir hier gebraut, gebrannt und destilliert, was möglich war. Unsere Männer haben auf ihren Fahrten in die USA fünfzigmalmehr verdient als wenn sie auf Fischfang gegangen wären. Den haben sie nur aus Gründen der perfekten Tarnung unterwegs weiter betrieben."
Georg griff nach einem der Krüge, entkorkte ihn, füllte sich seinen keramisierten Blechbecher voll und nahm einen Probeschluck. Dann stöhnte er geradezu auf. „Großartig. Tut das gut." Er lehrte seinen Becher mit einem großen zweiten Schluck. „Wie heißt der göttliche Nektar?" schaute er seinen Wetterpartner an.
„Ambrosia."
„Genau. Das ist mein Ambrosia."
Die Stimmung zwischen den beiden Wettersoldaten und Mutter und Tochter Safrane war schlagartig entspannt. Nachdem sich die Frauen pflichtgemäß um das Leuchtfeuer gekümmert hatten, saßen sie noch eine halbe Stunde vor dem Leuchtturmwärtercottage und tratschten miteinander. So als ob sie sich bereits seit Jahren und nicht erst seit ein paar Stunden kennen würden. Fast zu spät machten sich die beiden Frauen auf den Heimweg.
„Findet ihr denn noch den Weg, wenn es dunkel geworden ist?" fragte Thomas etwas besorgt.
Geraldine lachte. „Erstens sind wir gewohnt, auch im Mondlicht sehen zu können. Und wenn der Mond nicht scheint, haben wir zwei batteriebetriebene Taschenlampen. Sind sogar amtliches Zubehör für den Dienst als Leuchtturmwärter." Sie griff in ihre Tragetasche und holte eine Taschenlampe hervor. „Wir sind hier zwar auf einem der entferntesten Außenposten der großen französischen Republik. Aber deshalb nicht am Ende der Welt." Dabei funkelte ihr Temperament wieder wie Diamanten aus ihren Augen.
Nachdem Thomas seine abendliche Kurzwettermeldung abgesetzt und Georg das Abendessen auf den Tisch gestellt hatte, diskutierten die beiden Männer noch intensiv die Strukturierung ihres zukünftigen Tagesrhythmus durch. „So ein Dienstplan hat den Vorteil, dass man nicht verlodert und bequem und faul wird", begründete Georg die Notwendigkeit eines Dienstplans. Thomas akzeptierte seine Sichtweise und so baute sich in den kommenden Tagen und Wochen ein fester Tages- und Aufgabenrhythmus auf, der neben der eigentlichen Wetterbeobachtung und -dokumentation der Messwerte für Thomas die Jagd auf Kaninchen und anderes Niederwild und für Georg die Haushaltsführung und die Zubereitung der Mahlzeiten beinhaltete. Die beiden Männer hatten hierzu zwei verschiedene Jagdgewehre mitgenommen, eine Geschoßflinte, die sich mangels Rotwild und anderen Großwilds als absolut untauglich erwies und eine doppelläufige Schrotflinte, die nun mehrfach pro Woche zum Einsatz kam und in diesen Frühlingstagen für ununterbrochenen Nachschub an Frischfleisch sorgte.
Durch die täglichen Leuchtturmbesuche eines weiblichen Mitglieds der Familie Safrane kam auch keine zweisame Langweile zwischen Georg und Thomas auf. Beide waren den ganzen Tag mit ihren Aufgaben und ihrem Alltagsleben gut beschäftigt, abends spielten beide gern eine Partie Schach, Dame oder Mühle, wobei Thomas aufpassen musste, nicht demotivierend überlegen zu sein.
Drei Wochen später waren die Safrane-Frauen und die beiden getarnten Wettersoldaten bereits so miteinander vertraut, dass Geraldine Safrane die Männer zum Ostersonntags-Gottesdienst und anschließenden Ostermahl in ihr Haus nach Miquelon einlud. „Wir haben seit achtzig Jahren einen wunderbare Holzkirche in unserem Ort, in der von Taufen über Festtagsgottesdiensten, sowie Hochzeiten bis zu Trauergottesdiensten das gesamte Leben abläuft. Dazu haben wir mit Vater Augustin einen wunderbaren Priester", erzählte sie bei ihrem nachmittäglichen Arbeitsbesuch am Leuchtturm. „Ihr seid herzlich eingeladen, uns am Ostersonntag zu begleiten und anschließend Gast in meinem Haus zu sein."
Georg und Thomas kamen nicht umhin, die Einladung anzunehmen. „Wenn ich ehrlich bin, schmeckt mir die Osterfeier in aller Öffentlichkeit in Miquelon nicht besonders gut", gestand Georg. „Dadurch wird viel zu vielen Menschen bekannt, das wir hier am Leuchtturm leben und arbeiten. Ich hoffe, da kommen keine dummen Fragen auf."
Thomas war ebenfalls skeptisch, aber in einem Punkt hoffnungsvoll. „Wenn wir als Begleiter von Geraldine, Madeleine und ihren Schwestern wie als Teil der Familie auftreten, ist das Risiko vermutlich kleiner. Die Familie hat halt keine Männer mehr."
Thomas Langlois sollte recht behalten. Natürlich betrachtete die Gemeinde im Kirchenschiff der überraschend großen und prachtvollen, hölzernen Kirche Notre-Dame-des-Ardilliers die beiden fremden Männer in ihren dunkelblauen Uniformen mit dem Wappen des staatlichen französischen Wetterdienstes am Ärmel mit Neugierde und Skepsis. Aber niemand in der voll besetzten katholischen Kirche der kleinen Insel Miquelon ahnte auch nur im Entferntesten, dass sich unter ihnen zwei deutsche Soldaten auf einer höchst wichtigen Geheimmission befanden.
„Ist schon viele Jahre her, dass ich in einem Ostersonntagsgottesdienst war", gestand Georg seinem Kameraden.
Der Angesprochene nickte zustimmend. „Bei mir in der Oberprima. Also auch viele Jahre."
Trotz der langen Pause war ihnen aber die lateinische Liturgie immer noch so weit vertraut, dass sie nicht weiter auffielen. Nach dem Gottesdienst lief Familie Safrane mit ihren Gästen quer durch den kleinen Ort, der weitestgehend aus überraschend guten und wohl gepflegten Häusern bestand. „Verdanken wir alles dem teuflischen Alkohol", lachte Geraldine Safrane als sie strammen Schrittes mit ausladender Geste das Ortsbild nachzeichnete. „Ich bin im Leuchtturmwärterhaus aufgewachsen, da bestand Miquelon aus einer Ansammlung von armseligen Fischerhütten. Lediglich unsere Kirche war schon so wie heute. Selbst unsere Schule war eigentlich eine armselige Kate. Dann kam die amerikanische Prohibition und wir hatten eine einmalige Chance, gutes Geld zu verdienen. Und das haben wir für unseren Ort ausgegeben. Jetzt haben wir neue Häuser und einen guten Hafen. Dazu haben wir einen Arzt und einen Zahnarzt. Und die Kinder haben eine ordentliche Schule und eine richtig gut bestückte Bücherei."
„Oh, eine Bücherei? Hier?"
„Ja", antwortete Madeleine und deutete auf ein größeres Holzhaus am Ende der Seitenstraße, die sie gerade passierten. Das ist unsere Schule und dort ist auch die Bücherei. Öffentlich, also für jedermann, nicht nur für Schüler."
„Ich kann Euch gleich Leserausweise ausstellen", mischte sich jetzt auch Madeleines jüngere Schwester, die achtzehnjährige Marie, ein. „Ich will Bibliothekar werden und lerne dort gerade."
„Dann bin ich an diesem Sonntag gleich der erste neue Leser", freute sich Thomas. „Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, an unserem Standort eine Bücherei vorzufinden."
Geraldine lachte wieder ihr warmes, gewinnendes Lachen. „Selbst diesen Komfort verdankt ihr dem Alkohol", strahlte sie Thomas an. „Die Bücherei ist eine Spende der drei Destillerien. Wir hatten in der goldenen Zeit so viel Geld übrig, dass wir freiwillig viele nützliche Sachen gespendet haben. Auch die Einrichtung der Zahnarztpraxis war eine solche Spende."
Mit diesem kurzen Ausflug in die Heimatkunde hatten sie das Zuhause der Familie Safrane erreicht. „Willkommen in unserem männerfreien Zuhause", begrüßte die Familienmutter mit hörbar sarkastischem Unterton ihre beiden Gäste, als sie das Haus betraten.
Neugierig und wissbegierig, wie er war, vielleicht auch ein wenig taktlos, kam Thomas Langlois während des Tischgesprächs nach dem Hauptgang auf Geraldines Begrüßung zurück. „Ihr habt das schon zweimal erwähnt und auch Madeleine machte entsprechende Andeutungen, wenn sie ihrer Leuchtturmarbeit nachging. Warum ist eine Familie von so schönen Frauen ein männerloser Haushalt?"
Geraldine atmete zweimal hörbar tief durch und seufzte deutlich. „1940 war für unsere Familie ein schreckliches Jahr, meine Herren." Sie schaute wechselweise Thomas und Georg an. „Wenn man in einem Fischerort mit seegehenden Kuttern lebt, ist der nasse Tod immer gegenwärtig. 1926 haben wir in einem weit nach Norden ziehenden Hurrikan zwei Kutter aus Miquelon verloren; sind mit Mann und Maus untergegangen. Mein Claude war auf dem dritten Kutter, dem einzigen Boot, das den Rückweg aus Maine geschafft hatte. Er hat später erzählt, dass er nie in seinem Leben einen solche Wellengang erlebt hätte. Seit der Fahrt ist er nie wieder zur See gefahren. Er hat sich dann nur noch um unsere Destillerie und um den Leuchtturm gekümmert. Claude ist vor Weihnachten nach kurzer Krankheit gestorben, gerade mal 48 Jahre alt. Er hat irgendwie den Tod von Georges und Pierre nicht verkraftet."
In Thomas und Georgs Gesicht waren deutliche Fragezeichen zu sehen, so dass Madeleine die entstandene Pause zur Erläuterung nutzte. „Georges war mein jüngerer Bruder und Pierre mein Ehemann. Wir haben zwei Wochen vor Kriegsbeginn geheiratet. Die beiden haben ihren Kriegsdienst in der französischen Marine abgeleistet. Auf dem Schlachtschiff ‚Bretagne', dass die Engländer bei ihrem Angriff auf die französische Flotte am 3. Juli so frevelhaft versenkt haben. Dabei sind unsere beiden Jungs ums Leben gekommen. Zusammen mit über tausend anderen jungen Männern." Madeleine klang bitter und zugleich zornig.
„Ist wie die ganze Geschichte dieser französischen Inseln und ihren englisch-kanadischen Nachbarn", klang Geraldine noch grimmiger. „Nie haben uns diese Imperialisten in Ruhe gelassen. Sie haben unsere Fischgründe geplündert, zwischenzeitlich immer wieder besetzt und gegängelt. Und unseren Alkoholhandel haben sie auch versucht, zu torpedieren. Weil sie das Geschäft für sich allein haben wollten. Den Konflikt haben dann unsere amerikanischen Abnehmer beendet, als sie den Engländern klar gemacht haben, dass sie darauf bestehen würden, von beiden Seiten beliefert zu werden. Der Grund war einfach: sie befürchteten, dass die amerikanische Regierung mächtig genug wäre, Kanada ebenfalls in die Prohibition zu zwingen. Sind halt Abstinenzler und Puritaner auf beiden Seiten der Grenze."
Die Atmosphäre bei Tisch an diesem Ostersonntag war spürbar aggressiv geworden. Der Tod der drei männlichen Familienmitglieder hatte die Frauen tief getroffen. Um so erleichterter waren Thomas und Georg als Geraldine in ihre Hände klatschte und ein trotzig-freundliches Gesicht aufsetzte. „Trauer und Zorn bringen uns nicht weiter. Und auch nicht unsere Männer zurück." Sie schaute die beiden Wettersoldaten an. „Wir haben so viel vom Alkohol gesprochen, jetzt bekommt ihr zusammen mit dem Dessert eine Kostprobe aus unserer eigenen Destillerie."
„Euch gehört eine eigene Destillerie?" Georg schaute seine Gastgeberinnen bewundernd und zugleich neugierig an.
„Ja", lächelte Geraldine als Antwort, „die einzige Destillerie in Miquelon, die noch arbeitet. Verdanken wir meinem Claude." Sie winkte Madeleine, die daraufhin ein silbernes Tablett mit edlen Gläsern und zwei kleinen Flaschen mit klarem Inhalt auf den Tisch stellte. „Als 1919 in Amerika die Prohibition begann, haben wir hier zuerst eine Art Whisky produziert. Eigentlich war das nicht mehr als auf geräucherter Gerstenbasis destillierter Schnaps. Whisky soll eigentlich für Monate oder Jahre in Fässern reifen, aber für so einen Quatsch hatte niemand Zeit. Weder unsere Abnehmer, die nach immer mehr Ware schrien, noch wir Produzenten. Ich muss zugeben, dass auch unser Whisky eigentlich nur ein alkoholstarkes Gesöff war. Claude hat sich dann damit beschäftigt, wie man aus dem ursprünglichen, eigentlich neutralen Destillat etwas machen konnte, das besser schmeckte und auch für Frauen trinkbar war. Denn das lernten wir von unseren amerikanischen Abnehmern sehr schnell. Auch die amerikanischen Frauen begannen in immer größerer Zahl, nach alkoholischen Getränken zu verlangen. Ich habe dann zwei Bücher besorgt, in denen wir viele Informationen über die Herstellung von Gin fanden. Denn die dafür notwendigen Wacholderbeeren, aber auch andere geeignete Beerensorten wachsen hier auf unserer Insel. Und so haben wir unsere Destillerie auf die Gin-Produktion umgestellt. Das funktioniert bis heute, während die hiesige Whiskyproduktion mangels Nachfrage mittlerweile eingestellt ist." Mit dieser Erläuterung füllte Geraldine fünf Gläser mit Wacholder-Gin, verteilte diese und prostete den Anwesenden zu. „Cheers."