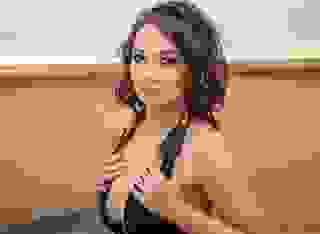- Keine Erotik
- Downtown No. 01
- Seite 2
Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hierDie beiden Bullen waren wohl ein wenig rabiat bei meiner Verhaftung vorgegangen, denn als sie mich aus der Zelle führten, konnte ich sofort meine Sachen an mich nehmen (ein Rasierspiegel, ein defekter Kugelschreiber, ein paar Münzen, ein Stück Draht und das kleine Taschenradio) und mich davon machen. Obwohl ich keinen Ausweis vorzeigen konnte, den hatte ich schon vor zwei Jahren hinter einem losen Stein unter der alten Brücke versteckt, aus Angst man könne mich mit dem möglichen Mord an einem menschlichen Kleiderschrank in Verbindung bringen, schien es sehr wichtig für die Beamten zu sein, mich so schnell wie möglich los zu werden. Wahrscheinlich waren die der Grund für die riesige Wölbung an meiner Stirn.
Mir war das egal. Ich war sogar froh darüber, denn jetzt konnte ich mir einige Hoffnungen machen, dass die Suche nach mir aufgegeben wurde, wenn überhaupt jemals so etwas stattgefunden hatte. Wie gesagt, meine Frau diese Schlampe konnte sich nach der Sache im Teich sicher sein, dass ich nie wieder auftauchen würde. Aber was rede ich? Diese Dinge sind schon lange Geschichte. Soll sie doch mit ihm glücklich werden. Die Kinder sind auch schon fast erwachsen und brauchen mich nicht mehr. Warum also nicht ein Leben in Freiheit leben?
4
Ein Hinterhof.
Hier gibt es keine Sonne. Ich warte gebückt in einem der dunkleren Schatten. Es riecht nach Katzen und Pisse. Die grauen Häuserwände sind sichtbar mit Feuchtigkeit durchzogen. Der Putz ist brüchig und an einigen Stellen ist das nackte Mauerwerk zu sehen. Die schmalen hohen Fenster sind verschmiert. Überall stehen Fahrräder. Verrostete Metallpfosten tragen die Überreste einer verschimmelten Wäscheleine. Darunter liegen alte Bretter. Ein blauer Sandkasten aus Kunststoff lehnt an eine Mauer. Ein unförmiges Loch klafft aus seinem Boden. Der Sand liegt überall verstreut in dunklen Klumpen. Irgendwo sitzt eine Katze und leckt ihre Pfoten.
Aus einer der Wohnungen ertönt leise orientalische Musik. Ansonsten herrscht Stille.
Meine Füße tun weh. Ich habe Löcher in den Schuhen. Sie sind alt und haben eine lange Strecke hinter sich, daher nehme ich es ihnen nicht übel. Ich will eine rauchen. Immer wieder greife ich in meine Jackentasche und fummele an den übrigen Zigaretten herum. Doch sie würden meinen Durst verschlimmern, daher lasse ich es sein. Außerdem, wenn alles gut läuft, werden diese Probleme bald vergessen sein.
Endlich höre ich Schritte. Erst entfernt, dann immer näher kommend. Obwohl ich die Richtung, aus der das Geräusch kommt nicht einsehen kann, bin ich mir ziemlich sicher zu wissen, wer da meinen Weg auf so schicksalhafte Weise kreuzen wird. Es ist der Straßenmaler. Ich habe ihn die letzten Tage beobachtet. Er wohnt in der Nähe des Hafens, ein paar Blocks südlich der Einkaufstraße. Wenn es Abend wird und das Licht zum Malen schwindet, geht er immer zuerst in seine Wohnung, um seine Kreide und Wachsstifte zu deponieren. Dabei meidet er die großen Straßen und versucht mit Abkürzungen wie diesem Innenhof so schnell wie möglich sein Ziel zu erreichen.
Er ist ein entfernter Verwandter. Auch er spürt den Durst, besucht aber die Kneipen und Pubs. Durch das Malen kann er sich das leisten.
Die Schritte werden lauter. Ein gesundes, hölzernes Klacken. Seine Schuhe sind in guter Verfassung. Jetzt sehe ich ihn. Er geht an mir vorbei, nur zwei Meter entfernt, bemerkt mich aber nicht. Auf seinem erhobenen Haupt thront der abgewetzte Zylinder, mit dem er eben noch seine Gage eingesammelt hat. Unter seinem linken Arm hat er seine Malutensilien eingeklemmt. Obwohl er nichts weiter als ein weiterer Saufbruder - mit einigen zugegebenermaßen recht passablen Talenten ausgestattet - ist, hat er eine besonders arrogante Art sich fortzubewegen. Leicht, fast geschmeidig gleitet er über den schmutzigen Beton, als würde er auf einem roten Teppich dahin schreiten, als gern gesehener Gast irgendeiner High-Society-Gala. Ich kauere dicht an die Wand gepresst im dunklen Schatten, ohne zu atmen. Der beißende Duft seines Aftershaves überdeckt für einen kurzen Moment den ätzenden Gestank des Hinterhofs. Ich muss mich beeilen, den Überraschungsmoment ausnutzen. Und das wichtigste: alles muss lautlos über die Bühne gehen. Hinter den schmierigen Fenstern könnten Menschen wohnen, denen noch nicht alles egal ist, und Alarm schlagen.
Zu lange habe ich diesen Moment herbei gesehnt, beobachtet, Pläne geschmiedet. Meine Hände ballen sich zu Fäusten. Lautlos trete ich einen Schritt aus dem Schatten. Meine Rechte wandert zu der Innentasche meiner Jacke und umgreift den Griff des Gummihammers, den ich vor zwei Tagen von einer Baustelle gestohlen habe. Schwer liegt er in meiner Hand. Für einen Moment kann ich mich nicht entscheiden, ob ich die ganze Sache nicht doch sein lassen soll. Ich habe im Grunde ja gar nichts gegen den alten Künstler. Ich zögere. Schweiß macht sich auf meiner Stirn breit und ein kalter Schauer schleicht über meinen Rücken. Oh nein, ich werde es verpatzen. All die Zeit des Beobachtens, vertan. Schnell, gleich hat er den Hinterhof verlassen. Entscheide dich. Ich schließe kurz die Augen und schalte alles Denken aus. Meine rechte Faust verstärkt den Druck auf den harten Stiel des Hammers. Ich habe mich entschieden. Ich gehe zwei Schritte, hole aus und öffne die Augen.
Der Maler bleibt auf einmal stehen und blickt ruckartig zu einem der Fenster hinauf. Ich erstarre. Verkrampft, mit dem Hammer hoch über meinem Kopf, stehe ich keinen Meter hinter ihm und will am liebsten schreien. Zum Glück habe ich schon lange nichts mehr getrunken, sonst hätte ich mir ohne Zweifel in die Hose gepisst. Mein Herz pocht wie wild. Steht da etwa jemand am Fenster und beobachtet, wie ich gerade diesem Kerl eins über den Schädel geben will? Ich schaue nach oben, in die gleiche Richtung, die der Maler anvisiert. Da oben ist es nicht so dunkel wie hier, trotzdem kann man nur wenig erkennen. Ein paar schmale Fenster, eingelassen in eine rissige graue Wand, sonst nichts.
Ich habe Probleme mein Gleichgewicht zu halten. Mich durchströmt ein Gefühl ertappt worden zu sein, so als übertritt man im Traum zwei Stufen einer Treppe gleichzeitig, um erschrocken davon aufzuwachen.
Ein merkwürdiges Bild muss das sein. Da stehen nun zwei Kerle, zuerst ein kleiner alter Mann mit übergroßem Zylinder auf dem Kopf und einer Tasche mit Malzeug unterm Arm und dann ein verwahrloster Penner, der direkt hinter dem Alten steht und einen schweren Hammer in die Höhe hält. Und beide schauen den feuchten Putz einer Hinterhofwand an.
In dem Moment vernehme ich wieder diese leise orientalische Musik. Ich bin mir nicht sicher, ob es das gleiche Stück ist wie zuvor, aber es scheint aus der genannten Richtung zu kommen. Es hört sich an, als würde eine alte Türkin um das Leben eines geliebten verschiedenen Menschen trauern. Nicht dass ich da aus Erfahrung sprechen kann.
Ich entspanne mich ein wenig. Glück gehabt. Ich konzentriere mich wieder auf den Maler, lockere meinen Arm ein wenig, hole noch weiter aus und-
Der Maler nimmt den übergroßen Zylinder von seinem Kopf, so dass ich den streng gebundenen Zopf am Hinterkopf erblicke. Dann beginnt er zu summen und seinen Oberkörper zu der traurigen Melodie zu wiegen. Er scheint das Stück zu kennen.
So wie er dasteht, ganz in den sanften Wogen der Musik verschlungen, wirkt er wie ein kleines Kind, so lebensfroh, liebenswert und so verletzlich.
Das war es also. Sofort entkrampfen sich meine Muskeln. Ich kann es nicht. Mein Arm sinkt nach unten. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Gut, ich wollte ihn von Vornherein nicht umbringen, nur bewusstlos schlagen, seine Schlüssel und sein Portemonnaie klauen, in die Wohnung rennen, seinen Sparstrumpf finden und die Stadt mit dem nächsten Zug nach Süden verlassen, wo ich nicht frierend unter irgendeiner Brücke sitzen muss, den nächsten Tag abwartend, auf sonnige Wärme hoffend.
Aber was für eine abscheuliche Tat es trotzdem wäre. Woher sollte ich denn wissen, wie ich den Schlag mit dem Hammer genau dosieren muss, dass er narkotisierend aber nicht tödlich ausfällt? Wie hätte ich mit einem möglichen Mord leben können?
Nein, schämen sollte ich mich. Es tut mir Leid, mein lieber alter Maler, dass ich derart schlimme Gedanken gegen dich führte. Schwelge du nur in deiner Musik, ich werde dich nicht stören und lasse dich am Leben.
Der Hammer sinkt langsam nach unten. Während der Maler immer noch tief in seinen von orientalischer Musik begleiteten Träumen versunken ist, trete ich leise zwei Schritte zurück, zurück in den Schatten. Mit dem Rücken zur Mauer, gleite ich langsam hinab. Ich erlebe einen Moment wahrer Schönheit. Die Musik erklingt jetzt viel lauter als zuvor, sie ist wunderschön. Meine Augen sind geschlossen, der Durst ist verschwunden und ich erlebe hier etwas altes, etwas dass ich schon so lange nicht mehr in mir, meinem verrosteten Herzen spürte, und es durchfließt mich von Kopf bis Fuß, Hitze steigt in mir in die Wangen und als ich wieder die Augen öffne und den alten Mann keine drei Schritte vor mir stehen sehe, wie er sich immer noch zu den Klängen wiegt, verlässt eine einzige Träne meine Augen. So wie man die vernachlässigten Seiten eines alten Klaviers nach Jahren in dunklen Lagerhallen entstaubt und erneut stimmt, fühle ich etwas zurückkehren, das Glück, das Leben? Wer weiß, es ist fantastisch.
Ich schließe erneut meine Augen, nichts soll dieses Gefühl unterbrechen, keine Schatten, kein Dreck, nichts Bekanntes. Vollkommenheit, ja, die Ewigkeit, in diesem einen Moment.
So verharre ich noch lange nachdem der Maler gegangen ist, unwissend, vielleicht eben so glücklich wie ich es bin. Und dann kommt der Schlaf.
5
Das alte Spiel, zurück in meiner Welt. Ich stehe vor dem Regal und es ist voll von Träumen, weniger schönen Träumen, nicht zu vergleichen mit dem, welcher mich erst kurz zuvor noch umspülte, aber immerhin sind es Träume.
Eine Flasche ist bereits in meinem Mantel verschwunden. Ein teurer Wein, heute ist ein besonderer Tag. Noch immer stehe ich da und spiele den Unentschlossenen, während mich die Kassiererin in dem halbkreisförmigen Spiegel auffällig beobachtet. Sie weiß nicht, dass ich mich bereits entschieden habe und die Ware längst verstaut ist. Selbst sie muss hin und wieder arbeiten. Doch ganz so unrecht hat sich gar nicht mit meiner Unentschlossenheit. Nur geht es nicht um ein Getränk, welches ich erwerben will sondern um die Frage, ob ich das Risiko eingehen soll, die von ihr behütete Kasse zu entleeren? Ich besitze weder einen Revolver noch sonst irgendwelche treffenden Argumente für ein solches Unternehmen. Nun ja, da wäre ja noch der Hammer. Hat jemals wer seine Beute mit der Drohung eines Hammerschlags erobert?
Gespielt entschließe ich mich keine der akribisch einsortierten Flaschen zu kaufen. Doch während ich der Kasse und ihrer Kaugummi kauenden Benutzerin näher komme, nimmt die Verkrampfung in meiner linken Hand immer stärker zu. Es ist die Hand, welche den Hammer hält.
Tausend Gedanken schießen mir durch den Kopf, ich bin vollkommen durcheinander. Meine Augen brennen sich durch die dünnen Wände des Kassierautomaten. Sie erfassen dicke Bündel verschieden farbiger Scheine, Berge von Münzen, Synonyme für die Fahrkarte in südlichere Gefilde. Mein Blick zieht mich förmlich zu diesem möglichen neuen Leben hin, doch meine Beine weichen keinen Zentimeter von ihrer festgelegten Route „durch die Tür und nichts wie weg" ab. Mein Verstand versucht in diesem Moment durchzudringen, der Schlichter zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Er entscheidet sich für die Wirklichkeit und löst den Krampf in meinen Fingern.
„Stop!" Die Kassiererin verlässt ihren Arbeitsplatz und stellt sich mir in den Weg. Das Kaugummi gekonnt in der Wangentasche verstaut.
„Dürfte ich mal sehen, was sie da in der Tasche haben?" Sie weist auf meine linke Manteltasche. Die Verkrampfung kehrt zurück und obwohl ich lange nichts mehr getrunken habe, spüre ich einen frischen Druck auf meiner Blase.
„Das ist ein Hammer. Ich habe einen Hammer in der Tasche." In diesem Moment fühle ich mich ertappter als vorher. Das ist ja nicht irgendein Hammer, beinahe wäre er eine Mordwaffe oder so was gewesen. Ich trete einen Schritt zurück.
„Hören Sie, ich will hier keinen Ärger. Ich will nur sehen, was sie da in der Tasche haben. Das ist mein Job, ok?" Das Kaugummi wandert in die gegenüberliegende Wange. Auch sie ist alles andere als entspannt.
„Ich verstehe." Ich ertappe mich bei einer Lüge.
Langsam ziehe ich den Hammer hervor.
„Das Geld. Geben sie mir das Geld!" Mit einer kurzen Kopfbewegung deute ich auf die Kasse, während mein Verstand vorübergehend ausgeschaltet ist. Pures Adrenalin Schießt mir in den Kopf.
„Sofort!"
Sie ist erstarrt. Ihr Blick haftet an dem klobigen Werkzeug.
„Was...?"
„Bitte. Ich habe nicht viel Zeit. Das Geld, gehen sie zur Kasse und geben sie mir das Geld. Schnell"
Mein Arm macht eine drohende Bewegung, wie von selbst. Wie sie bin ich nur Zuschauer meiner Vorstellung.
Ihre Erstarrung löst sich. Jetzt bewegt sie sich zurück, zurück zur Tür.
„Bitte. Ich will ihnen nicht wehtun. Geben sie mir einfach nur das Geld."
Ich ergreife ihren Arm mit meiner Rechten und ziehe sie zurück Richtung Kasse.
„Beeilen sie sich." Ich finde eine Tüte.
„Hier, schnell. Alles da rein."
Ich spüre wie das Blut meinen linken Arm verlässt, der noch immer den Hammer drohend in der Höhe hält.
„Bitte tun sie mir nichts!" Erste Tränen rinnen ihr übers Gesicht. Hastig füllt sie die Tüte. Ich achte nicht auf die Höhe meiner Beute. Die Tür ist mir viel wichtiger. Was wenn jetzt irgendein Kunde den Laden betritt?
„Bitte, tun sie mir nichts." Kurze Pause. „Auch die Münzen?"
Sie bringt mich völlig durcheinander.
„Scheiße, ich - alles in die Tüte." Die Tür. Sie soll sich beeilen.
Ich erlaube mir einen kurzen Blick in die Kasse.
„OK, gib mir die Tüte!" Ich entreiße sie ihren Händen. Sie sinkt auf ihre Knie. Sie weint. Sie hat Angst. Mein linker Arm ist eingeschlafen. Ich senke den Hammer. Ein kribbelndes Gefühl breitet sich aus, während das Blut durch meine Adern fließt. Obwohl ich so aufgeregt bin, kann ich meine Augen nicht von ihrem weinenden Gesicht wenden. Ein Teil meines Verstandes rät mir zur sofortigen Flucht, doch irgendwie tut sie mir leid. Ich beuge mich hinunter, sie ist auf den Boden geglitten, ihre Knie dicht an die Brust gezogen.
„Hör zu - Susanne!" Sie trägt ein Namensschild.
„Ich gehe jetzt da raus und du wirst die Tür schließen, ok? Dann versteckst du dich da hinten, hinter irgendeinem Regal, so dass man dich nicht von der Straße aus sehen kann. Hast du verstanden?"
„Ja..."
„Sieh mich an! Öffne deine Augen und sieh mich an!"
Es dauert, doch sie öffnet ihre Augen. Ängstlich schaut sie mich an.
„Ich werde dir nichts tun, wenn du tust was ich dir sage. Ich verstehe, dass du Angst hast. Scheiße, hättest du mich nicht angesprochen wäre ich schon längst weg. Ist jetzt wohl zu spät. Wo sind die Schlüssel?"
„In meiner Tasche." Sie schluchzt, ich höre sie kaum.
„Her damit. Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde jetzt die Tür abschließen und durch die Hintertür verschwinden. Du bleibst hier ne Weile sitzen."
Während ich den Schlüsselbund nach dem Gesuchten durchstöbere, nehme ich eine kurze gleitende Bewegung im Augenwinkel wahr. Es ist eine Keksdose aus dünnem Blech, welche dumpf und mit einem kleinen Stich an meiner Schläfe aufschlägt. Susanne hatte in der Eile wohl nichts Besseres gefunden. Sie versucht sich los zu reißen, hat aber leider nicht bedacht, dass mein Schädel etwas mehr als den Schlag mit einer Blechdose aushält. Susanne ist klein und schlank, es macht mir nicht viel Mühe, sie wieder in ihre ehemalige Sitzposition zu befördern.
Ich bin nicht wirklich böse auf sie, halte es jetzt aber für erforderlich ihr klar zu machen, dass ich es ernst meine. Außerdem hat sie mein Gesicht gesehen, mir bleibt nichts anderes übrig als ihr zu drohen.
„OK. Was da gerade vorgefallen ist, vergessen wir jetzt mal ganz schnell. Ich habe nämlich nicht viel Zeit. Ist das der richtige Schlüssel?"
Ich halte ihr einen der vielen Sicherheitsschlüssel mit einer schwarzen Markierung vor die Nase.
Susanne blickt kurz auf. Ich sehe Scham und Enttäuschung.
„Ja." Trotzig.
„Gut. Wir sind fast durch, fehlt nur noch ihr Ausweis."
Irritiert schaut sie mich an.
„Wozu...- den habe ich heute nicht bei mir." Ihre Lüge schreit mich förmlich an.
„Ach wirklich? Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den hier zu benutzen." Die kalte Schwere des Hammerkopfs berührt ihre Schläfe.
„Immerhin hast du mich gesehen. Ich meine, du musst mich verstehen, ich will nicht in den Knast." Sie beginnt zu weinen und obwohl sie mich angelogen hat und ich die Drohung nicht ernst meine, habe ich ein schlechtes Gewissen. Es macht mir keinen Spaß sie so in Angst zu versetzen.
„Bitte... - lassen sie mich in Ruhe." Ihre Nase läuft. „Ich werde niemanden was sagen, bitte tun sie mir nichts."
„Dann tu was ich dir sage. Der Ausweis?" Sie zögert.
Der Aufschlag des Hammers dicht neben ihrem Kopf lässt sie aufschrecken. Mehrere Keksdosen explodieren. Sie schreit.
„WO IST ER?" Erneutes Zögern, ich hole wieder aus-
„In meiner Handtasche – bitte – in meiner Handtasche – tun sie mir nichts!"
„Wo ist die Handtasche?"
„Unter der Kasse."
„OK, bleiben sie hier sitzen und alles wird in einer Minute vorbei sein."
Falls Susanne eine Kämpfernatur ist, so hat sich dieser Charakterzug vorübergehend abgemeldet. Ihre Haltung entspricht der eines mutlosen Embryos, die Arme fest um die Knie geschlungen, mit ihren Händen den Kopf schützend.
Innerhalb weniger Augenblicke habe ich die Tür geschlossen und Susannes Ausweis gestohlen. Auf der Strasse ist niemand zu sehen.
„Alles klar. Susanne?" Sie zittert, schaut nicht auf.
„Hör zu, ich bin kein schlechter Mensch. Es tut mir leid, dass ich dir gedroht habe, aber das Geld ist für mich vielleicht die Fahrkarte in ein neues Leben. Kannst du das verstehen." Keine Reaktion.
„Wenn die Bullen dich nach meinem Aussehen fragen, sag ihnen einfach, ich hätte eine Mütze getragen, mit der ich mich maskiert habe bevor du mein Gesicht sehen konntest. Wenn du das für mich tust, wirst du mich nie wieder sehen. In Ordnung?" Wieder dieses Zögern. Dann regt sie sich. Sie hält mir ihre Hand entgegen und ohne mich anzuschauen-
„Versprochen?"
Ich nehme ihre Hand.
„Ich schwöre es."
6
Ein anderer Hinterhof.
Der Gestank nimmt zu. Überall Dreck, alte Kippen, leere Bierdosen und Einkaufstüten. Die Gasse ist einen Meter breit und sehr dunkel. Hoch über mir kann man Reste vom Tag erkennen.
Hier, weitab der frisch verputzten Fassaden der Einkaufsstraße sieht alles anders aus. Sogar die Menschen. Alles ist mir vertraut. In diesen Vierteln leben viele Ausländer, deren Kinderscharen lautstark durch die Straßen rennen. Sie tragen billige Kleidung über mageren Körpern und aufgeschürften Knien. Alle haben dunkle Haare, die Väter dunkle Bärte. Ich fühle mich hier heimischer als downtown. Willkommen bin ich aber auch hier nicht. Ein Penner ist ein Penner, egal wo. Aber das ist ok. Ich kann damit gut leben, solange man mich in Ruhe lässt.
Ich lasse weitere Gassen hinter mir. Langsam wird es dunkel. Die Flasche ist noch halbvoll und es geht mir bestens. Ich gehe am Fluss spazieren. Ich befinde mich auf einer Insel. Downtown liegt inmitten einer Bucht, die auf allen Seiten besiedelt ist. Der Leuchtturm einer riesigen Stadt. Eine sehr alte Brücke verbindet Downtown auf dieser Seite mit dem nächsten Stadtteil. Ich stehe davor und betrachte sie. Dabei trinke ich. Betäube mein schlechtes Gewissen.
Unter der Brücke bewegen sich Leute. Sie tragen lange Mäntel und Sportjacken, fleckige Jeans und Joggingschuhe. Sie können nicht gerade stehen, sind immer am Taumeln. Die Flasche wird herum gereicht.