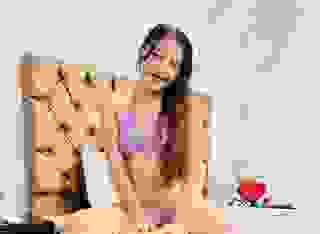- Lesbischer Sex
- Ohne Liebe keine Zukunft-Edited
Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hierOhne Liebe keine Zukunft
Wenn Liebe den Tod besiegt
Es war September. Ein kalter September.
Ich saß, wie so oft, auf „meiner" Parkbank am Fluss, starrte auf die grauen Wellen, versunken in mich selbst.
Seit drei Jahren ging das so.
Nahezu jeden Tag das selbe Ritual.
Von meiner kleinen Wohnung, nur Minuten entfernt, führte mich mein Weg hin zu dem kleinen Bistro.
Ein großer Becher „Latte Macchiato" in der Hand, starre ich teilnahmslos, ohne irgend etwas wirklich zu sehen.
Ich warte nur noch.
Ich warte auf das Ende.
In vier Wochen würde ich dreißig werden.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit mein letzter Geburtstag.
Unwahrscheinlich, das daran sich noch was ändern ließe.
Ich bin krank.
Todkrank.
Schwere Leukämie.
Ohne Knochenmarkspende unheilbar.
Und die ist nicht in Sicht.
Und selbst wenn.
Wofür sollte ich es machen?
Es gab nichts für mich, wofür es sich zu leben lohnt.
Gar nichts.
Aber von Anfang an.
Geboren wurde ich, Julia, in einer Kleinstadt im Saarland als Tochter eines Beamtenpaares.
Eine mittelmäßige Stadt, mit mittelmäßigen Menschen.
Und auch meine Eltern waren nur mittelmäßig.
Genau wie meine Kindheit und Jugend.
Alles nur Mittelmaß.
Wieso ich geboren wurde, war mir immer ein Rätsel.
Ich passte so gar nicht in das leben meiner Eltern.
Das bestand nur aus Vorschriften, Regeln und verstaubten Aktendeckeln.
Und wie passte ich da rein?
Gar nicht!
War wahrscheinlich nur ein Unfall. Oder lag zufällig irgendwo in einem Aktenschrank herum.
Aber müßig darüber nachzudenken.
Von Anfang an war mein Leben grau.
Grau wie meine Eltern, die Kleinstadt und die Menschen, die dort wohnten.
Alles grau!
Und wahrscheinlich wäre ich genauso geworden, wenn ich „normal" gewesen wäre.
Doch irgendwas stimmte mit mir nicht.
Besonders klar wurde das, als ich in die Pubertät kam.
Jungs und Männer interessierten mich nicht.
OK. Zum Labern oder Feiern waren sie noch gut genug.
Aber als Partner??
Never!!
Mädchen und Frauen, ja, die fand ich interessant , sexy, verführerisch.
Also war eines klar.
Ich war lesbisch.
Wie gut das meine Eltern das, mit ihrem eingeschränkten Horizont, nicht gleich geschnallt haben.
Sie interessierten sich halt nicht besonders für mich.
Ich bekam Unterkunft, Essen und Kleidung.
Das war´s.
Aber als sie mitbekamen das ich auf Frauen stehe, waren sie entsetzt.
So eine „Perverse" in ihrer „heilen", grauen Beamtenwelt, das ging ja nun mal gar nicht.
Also wurde ich mit achtzehn, gerade mal das Abi in der Tasche, einfach vor die Türe gesetzt.
Ich ging nach Hamburg, begann eine Ausbildung in der Stadtverwaltung.
Und das ich ne Lesbe bin, interessierte in der großen Stadt niemanden.
Und genau in diese Zeit fiel auch mein erstes lesbisches Liebeserlebniss.
Sie war im selben Alter wie ich, wunderschön, ein eher südländischer Typ. So wie Selma Hayek.
Lange, schwarze Locken, eine rassige Erscheinung, mit eher kleinen Brüsten und einem süßen Muttermal auf der rechten Schulter in Form eines Schmetterlings.
Wir hatte nur eine Nacht.
Aber diese eine Nacht war für mich wie eine Offenbarung.
Noch nie hatte ich eine solche Zärtlichkeit erfahren.
Sanfte, liebevolle Küsse, zärtliches Streicheln, langsames Hochschrauben der Leidenschaft, die in einem Höhepunkt endete, der uns beiden den Atem raubte.
Wäre mein Leben anders verlaufen, wenn wir damals eine Chance gehabt hätten zusammen zu bleiben?
Wahrscheinlich.
Nein. Ganz sicher sogar.
Aber es sollte wohl nicht sein.
Morgens war sie weg.
Jedenfalls konnte ich sie nie wirklich vergessen.
Und so ging ich auf die Suche nach Mädchen und Frauen. Wollte dieses wunderbare Gefühl wieder spüren.
Liebe, Romantik, Zärtlichkeit, Erfüllung.
Doch was ich fand war.......Sex.
Reiner, hemmungsloser Sex.
Ohne tiefere Gefühle.
Einzig der körperlichen Befriedigung dienend.
Und ich spielte das Spiel mit.
Längst hatte ich meine Träume aufgegeben.
Vielleicht war es auch nur der sinnlose Versuch, dieses Gefühl doch noch einmal zu erleben.
Doch auch die Lesbenwelt ist oberflächlich.
Zumindest so lange, wie man noch nicht das passende Gegenstück zu einem selbst gefunden hat.
Doch ich fand es nicht.
Ich tobte mit dutzenden Frauen durchs Bett, jagte, erlegte, verführte Frauen wie am Fließband.
Ob es neugierige Studentinnen, vernachlässigte Ehefrauen
oder bindungsunwillige Discobekanntschaften waren, war mir so ziemlich egal.
Solange sie nicht aussahen wie halbe Kerle, waren sie mir als Gespielinnen recht.
Gefühlt hektoliterweise leckte ich den Mösennektar, gab im Tausch dafür den meinen.
Finger wurden in schlüpfrige Löcher gebohrt, Titten wurden gestreichelt, massiert und geknetet.
Immer das selbe Spiel.
Jeden Tag der selbe Ablauf.
Nur die Frau war jedes mal eine andere.
Sex war meine Droge geworden.
Ich betäubte damit, zumindest für ein paar Stunden, diese riesige Sehnsucht in mir.
Doch nach jeder Nacht in den Armen irgendeiner Fremden, kam sie zurück.
Schlimmer noch, als den Tag davor.
Wahrscheinlich war es eine Art Selbstschutz, das ich meine Gefühle irgendwo in mir wegsperrte, sie verkümmern ließ.
Ich war mit der Zeit zu einer leeren Hülle geworden.
Eine sehr hübsche, verführerische Hülle.
Und doch nur eine Hülle.
Unfähig und unwillig mich näher mit den Gefühlen meiner Bettgenossinnen zu beschäftigen.
Aber Gefühle kann man nicht ewig wegsperren.
Das wurde auch mir schmerzlich klar.
Und wenn ich mich nicht mit Sex ablenken konnte, heulte ich mich regelmäßig in den Schlaf.
Ich war einsam.
Selbst in Gesellschaft fühlte ich mich alleine.
Keine wirklichen Freunde.
Keine beste Freundin.
Und erst recht keine Partnerin.
Und mein Innerstes war so grau geworden, wie es früher mein Heimatort, das Leben meiner Eltern gewesen war.
Doch steckt man einmal in dieser Tretmühle, ist es verdammt schwer, da wieder raus zu kommen.
Wie oft hatte ich mir vorgenommen, mit dem sinnlosen Rumgeficke endlich aufzuhören.
Und wurde doch jedes mal rückfällig.
Ein Junkie.
Das war ich geworden.
Ein Sexjunkie.
Wie oft ich zitternd, wie eine Süchtige auf Entzug, auf meinem Bett gelegen hatte, mein Leben verfluchte und mich dann doch wieder, wider besseren Wissens, ins Nachtleben stürzte um Frauen aufzureißen, kann ich gar nicht sagen
.
Sehr oft.
Zu oft.
Viel zu oft.
Zumindest meinen Job erledigte ich noch mit schöner Regelmäßigkeit. Doch auch da trat ich auf der Stelle. Kam nicht weiter. Wollte es vielleicht auch gar nicht.
Aus mir war im Grunde das geworden, was ich an meinen Eltern immer so gehasst hatte.
Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat,
Jahr für Jahr.
Immer das selbe.
Bis eben vor etwa drei Jahren.
Ich war auf einer Geburtstagsfeier gewesen, die sich schnell in einer Lesbenorgie entwickelt hatte.
Müde, kaputt, mit schmerzenden Gliedern, stand ich zu Hause nackt vor dem Spiegel.
Was ich da sah, kotzte mich selbst an.
Eine eigentlich hübsche Frau, mit wundgeleckter Möse, blauen Flecken auf der schmerzenden Brüsten und einem Blick, der so tot war, das ich mich vor mir selbst fürchtete.
„Naja Julia," sagte ich zu mir selbst.
„Hast es ja wieder einmal gründlich übertrieben."
Damit war das Thema für mich erledigt.
Dachte ich.
Allerdings war mein Spiegelbild da völlig anderer Meinung.
„Schau dich mal an, du Schlampe," brüllte es mich an.
„Schau, was aus dir geworden ist."
Entsetzt sah ich in den Spiegel.
„Du hast es doch nicht anders verdient.
Eine Nacht warst du glücklich. Nur eine verdammte Nacht. Und du hast sie gehen lassen."
„Ich wusste doch nicht....," versuchte ich eine Entschuldigung.
„Ach halts Maul, du Bitch. Du bist doch so blöd, das es scheppert. Lässt die einzige Frau gehen, die du jemals geliebt hast. Und komm mir jetzt nicht damit:
„Ich war ja noch so jung, so naiv...heul."
Du warst einfach zu blöd, um zu erkennen, was Liebe ist. Zu blöd dein Glück fest zu halten. Zu dämlich, ihr zu sagen, das sie bleiben soll, das du sie brauchst und willst.
Das Einzige, wozu du damals dein Maul aufgemacht hast,war, um ihr deine Zunge in den Hals und in die Fotze zu stecken. Ansonsten hast du die Fresse gehalten. Schon mal auf die Idee gekommen, das sie vielleicht genauso empfunden hat? Sie nur auf ein Wort von dir gewartet hat?
Nee. Auch dafür bist du zu blöd."
Jedes Wort, jeder Satz meines Spiegelbildes war wie eine schallende Ohrfeige gewesen.
Und das Schlimmste daran war.
Es hatte vollkommen recht.
Zumindest war für diesen Tag die Standpauke vorbei.
Das es noch viel schlimmer kommen sollte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen.
Die blauen Flecken auf meinen Brüsten verschwanden nicht. Und auch auf meinem restlichen Körper tauchten bei Berührungen rätselhafte Hämatome auf.
Eine Woche nach dem Anschiss durch mein Spiegelbild ging ich zum Arzt.
Als er mich sah, überwies er mich noch am selben Tag in die Klinik. Und nur wenige Stunden später, saß ich dem Chefarzt gegenüber.
„Frau Graz. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für sie. Wir haben in ihrem Blut besorgniserregende Werte festgestellt, die eine sofortige Behandlung erfordern."
„Was wollen sie mir damit sagen,Herr Doktor."
verwirrt sah ich ihn an, verstand nicht wirklich, was er mir zu sagen versuchte.
„Sie haben Leukämie. Blutkrebs. Eine besonders aggressive Form."
Das war wie ein Schlag in die Magengrube.
Leukämie!!!
Meine Gedanken rasten.
„Da kann man doch bestimmt irgendwas tun. Oder?"
Doch sein nächster Satz zerstörte auch noch das letzte bisschen Hoffnung in mir.
„Frau Graz. Es tut mit leid. Aber auch wir können keine Wunder vollbringen. So gerne wir das auch würden. Das Einzige was sie heilen kann, ist eine Knochenmarkspende.
Wir können sie nur medikamentös behandeln, um den Fortschritt der Erkrankung etwas zu verlangsamen, mehr Zeit zu haben nach einem passenden Spender zu suchen. Mehr können wir nicht tun."
Es sah schon fast hilflos aus, wie er, als Fachmann, da so vor mir saß.
Der Boden war mir unter den Füssen weggezogen worden.
Einzig eine kleine Hoffnung blieb noch. Eine sehr winzige Hoffnung. So langsam realisierte ich das Gehörte.
Ich werde sterben.
Jeden Tag ein klein bisschen mehr.
„Haben sie irgendwelche Verwandte, die wir kontaktieren können. Die Wahrscheinlichkeit einen passenden Spender zu finden, ist innerhalb der Familie meist größten,"
unterbrach er mein dumpfes Brüten.
„Meine Eltern. Wohnen im Saarland. Beamte. Allerdings glaube ich nicht, das die mir helfen werden. Für die bin ich schon lange gestorben."
„Und warum, wenn ich fragen darf?"
„Ich entspreche eben nicht Ihren Vorstellungen,"
versuchte ich eine Erklärung.
„Entschuldigen Sie Frau Graz. Aber das kann ich nicht verstehen. Sie sind doch eine ganz patente Frau. Mit beiden Beinen voll im Leben. Und verzeihen Sie wenn ich das sage, aber sind dazu noch gutaussehend und anständig."
„Mag alles ja sein. Aber eine Tochter die Frauen liebt, passt eben nicht in Ihr Weltbild."
Meine Stimme klang bitter.
„Oh."
„Sehen Sie."
„Und das ist alles?"
Der Arzt sah mich völlig entgeistert an.
„Nur weil sie lesbisch sind, haben Ihre Eltern sie.....?"
Er suchte nach den passenden Worten.
„Verstoßen. Ja genau. Nur deswegen."
„Darf ich es trotzdem versuchen?"
„Mit Ihnen zu reden?"
„Ja!"
„Von mir aus."
Der Doktor schien hartnäckig zu sein.
Ich gab ihm die alte Nummer, die ich aus irgendeinem Grund noch hatte. Warum wusste ich selber nicht.
So wie ich meine Eltern kannte, wäre die wahrscheinlich
noch aktuell. Die hassen Veränderungen.
Der Arzt wählte die Nummer, schaltete das Telefon auf Lautsprecher.
Schon nach dem zweiten Klingeln wurde abgehoben.
„Graz."
„Ja hallo. Hier ist Doktor Wenger.
Universitätsklinikum Hamburg.
Es geht um Ihre Tochter Julia Graz."
„Wir haben keine Tochter," so die Antwort.
Dr. Wenger starrte auf das Telefon. Gab aber noch nicht auf.
„Entschuldigung. Aber Ihre Tochter hat Leukämie. Ich wollte sie bitten, sich testen zu lassen. Wegen einer Knochenmarkspende," fuhr er unbeirrt fort.
„Scheinbar haben sie es nicht verstanden," hörte ich meine Mutter sagen.
„Wir haben keine Tochter. Und uns testen zu lassen, nur damit diese Person ihr perverses Treiben fortsetzen kann,
steht ja wohl nicht zur Diskussion. Und jetzt schönen Tag und behelligen Sie uns nicht mehr!"
-KLICK- Aufgelegt.
„Ich hab es Ihnen doch gesagt," erklärte ich.
Die Reaktion meiner „Erzeuger" war nun wirklich keine Überraschung für mich gewesen.
Und trotzdem tat sie weh.
Nicht einmal jetzt, konnten oder wollten Sie über ihren Schatten springen.
„Diese intoleranten Arschlöcher," entfuhr es dem Arzt.
Ich zuckte nur mit den Schultern.
Es dauerte wirklich etwas, bis das er sich wieder beruhigt hatte. Sein Blick mir gegenüber drückte tiefes Mitgefühl aus.
Ich sah ihm an, das er nach tröstenden Worten suchte.
Und fand keine.
„Herr Doktor. Wie lange habe ich noch?"
Er räusperte sich. Seine Stimme war immer noch belegt.
„Ganz ehrlich Frau Graz. Wir wissen es nicht. Vielleicht achtzehn Monate. Vielleicht zwei Jahre. Ohne Behandlung. Mit Medikamenten vielleicht drei Jahre. Wenn wir bis dahin keinen Spender gefunden haben,
dann .........!"
Er ließ den Satz unvollendet.
Zwei bis drei Jahre.
Scheiße wenn man so lange zum Sterben braucht.
Vor allem wenn man alleine stirbt.
Alleine und einsam.
Äußerlich wirkte ich vielleicht relativ gefasst.
Doch in mir starb der letzte Rest meiner verfluchten Seele.
Der Rest, der mir noch geblieben war.
„Ich schreibe sie jedenfalls erst mal dauerhaft krank.
Und bete zu Gott das wir bald einen geeigneten Spender finden."
„Ihr Wort im Ohr des großen Gasförmigen," versuchte ich zu scherzen.
Nicht wirklich gelungen.
Galgenhumor.
Wie heißt es so schön?
„Tumor ist, wenn man trotzdem lacht."
Echt ein scheiß Satz.
Ich bekam noch nen ganzen Haufen an Medikamenten mit und den Plan wie sie einzunehmen sind.
Dann entließ mich der Arzt.
Gedankenverloren dackelte ich nach hause.
Plötzlich kam mir meine Wohnung nicht mehr nur winzig und leer vor, sondern fast schon wie ein Sarg.
Ich heulte mir den ganzen Frust von der Seele.
Stundenlang. Bis das ich vor Erschöpfung einschlief.
Am nächsten Morgen fühlte ich mich noch immer beschissen. Und sah auch so aus.
Erstmal ins Amt. Termin machen mit dem Chef.
Situation erklären.
Mein Boss war echt betroffen.
Naja.
Hilft mir nun auch nicht wirklich. Trotzdem nett.
Gott sei Dank hatte ich zwei Jahre vorher die Verwaltungsprüfung gemacht. Hatte somit Beamtenstatus.
Als Beamter bekommst du fast den kompletten Lohn weiter. Kein Krankengeld. Kein Hartz 4.
Wenigstens etwas.
Nicht sterben zu müssen wäre mir lieber.
Auf dem Heimweg fiel mir das Bistro auf. Nahe am Fluss. Die Parkbank nicht weit weg.
So wurde das Ritual geboren, was ich nahezu täglich absolvierte.
Ne große Latte holen und stundenlang auf den Fluss starren.
Hilft nicht. Tat aber auch nicht weh.
Immer noch besser, als in der leeren Wohnung zu versauern.
Grübeln tu ich sowieso.
Nach den Stadien der Trauer, der Wut und der Angst, war ich inzwischen in eine tiefe Lethargie gefallen.
Es war mir alles egal geworden.
Vielleicht war ich ein Fehler der Natur, der nun einfach korrigiert wurde.
Bin ich müde......schlafe ich.
Habe ich Hunger....esse ich etwas.
Was, ist mir inzwischen auch egal geworden.
Ich bezahlte Miete, Strom und Rechnungen. Automatisch.
Einkaufen nur das nötigste.
Klamotten schon ewig nicht mehr.
Wozu auch!
Ansonsten kriegte ich so gut wie nichts mehr mit.
Selbst der Wochentag, der Monat spielte keine Rolle mehr.
OK. Sonntags hatte das Bistro zu.
Das einzige, was ich mir noch merkte.
Der Rest der Welt ging einfach so vorbei.
Ich hatte alle Kontakte von früher, aus meiner wilden „Schlampenzeit", abgebrochen.
Auch die Lesbenwelt ist ziemlich oberflächlich.
Und so war es seit der Diagnose vorbei.
Kein Sex.
Nicht mal mehr Masturbation.
Ich wurde zu einem Neutrum.
Davon mal abgesehen, das ich es niemandem zumuten wollte, mir beim sterben zuzusehen.
Erst recht nicht einer Frau, die mich vielleicht liebt.
Und auf Mitleid kann ich verzichten.
Langsam merkte ich, das die Krankheit nicht folgenlos blieb. Ich war oft müde, schlaff und hatte Gelenkschmerzen. Das ich bisher drei Jahre durchgehalten hatte, grenzte schon an ein Wunder.
Trotzdem keinen Spender gefunden.
Der Arzt meinte, das mir vielleicht noch fünf Monate bleiben. Vielleicht ein halbes Jahr.
Die Sanduhr des Lebens also schon fast durchgelaufen.
Um Ostern herum würde es vorbei sein.
Und niemand, der mich vermissen würde.
Auch so ein scheiß Gefühl.
Irgendwo verscharrt.
Vergessen vom Rest der Welt.
Kein schönes Ende.
Aber nicht zu ändern.
Ich hatte sogar innerlich meinen Eltern verziehen.
Fast jedenfalls.
Sollen Sie in der Hölle schmoren.
Tränen verschleierten meinen eh schon trüben Blick.
Ich merkte nicht, das jemand sich „meiner" Parkbank näherte. Erst als diese Person sich setzte, mir eine weitere „Latte" reichte, bemerkte ich sie.
Eine Frau.
Etwa mein Alter.
Südländischer Typ.
Sehr hübsch. Sehr sehr hübsch.
Lange schwarze Haare. Tausende Locken.
Süßes Gesicht. Roter Kussmund.
Wäre früher für mich eine echte Traumfrau gewesen.
Wie gesagt. Früher.
„Hallo."
Ihre Stimme ist wie Samt. Weich und melodisch.
Erinnerungen kommen hoch.
So eine Stimme hatte „Sie".
Die Erinnerungen tun weh.
Verschwinden wieder.
„Hi," antwortete ich eher automatisch.
„Ich beobachte dich schon eine lange Zeit. Kommst schon lange. Fast jeden Tag. Holst dir immer ne Latte und sitzt dann hier."
„Drei Jahre schon."
Warum sagte ich das jetzt?
Zum Labern hatte ich wirklich keine Lust.
„Dir scheint es irgendwie nicht gut zu gehen."
„Gut erkannt," antwortete ich sarkastisch.
„Sorry. Sollte nicht so hart klingen."
Jetzt entschuldigte ich mich auch noch.
„Wartest du auf irgendwas?"
Stumm nickte ich.
„Und worauf?"
„Das Ende!"
Meine Stimme klang heiser. Ein dicker Kloß sitzt in meinem Hals. Nicht leicht über den eigenen Tod zu reden.
„Ich bin krank. Leukämie. Endstadium."
„Ohhh."
Eigenartigerweise hörte ich kein falsches Mitleid.
Besorgnis ja. Und echtes Mitgefühl.
„Keine Chance?"
„Bis jetzt kein Spender gefunden. Wird wohl auch nichts mehr."
Resignation in meiner Stimme.
„Ich warte bis das es endlich vorbei ist. Der Arzt sagt nur noch ein paar Monate."
„Warum kämpfst du nicht dagegen?"
„Wozu?"
Meine Antwort ließ sie zusammen zucken.
„Gibt es niemanden, dem du wichtig bist?"
Stumm schüttelte ich den Kopf.
Tränen verschleierten meinen Blick noch mehr.
„Mir bist du aber wichtig."
Überrascht schaute ich sie an.
Irgendwie erinnerte sie mich an jemanden.
Aber an wen?
Keine Ahnung.
Mein Hirn funktionierte auch nicht mehr wirklich.
„Wir kennen uns doch gar nicht."
„Vielleicht doch."
„Bloß weil ich seit drei Jahren hier fast täglich nen
Kaffee hole?"
„Ich sehe dich dann immer durchs Bürofenster."
„Aha. Dein Laden?"
Sie nickte.
„Vielleicht hätte ich dich viel früher ansprechen sollen. Aber du sahst immer so abwesend aus."
„Sorry. Bin kein guter Gesprächspartner."
„Hätte ich das doch alles früher gewusst," seufzte sie.
Mit diesem Satz konnte ich nun gar nichts anfangen.
„Hätte auch nichts geändert."
„Vielleicht doch," murmelte sie.
Überrascht sah ich sie an.
Und wieder hatte ich das Gefühl sie zu kennen.
Verdammt nochmal. Woher nur?
Wäre sie eine meiner unzähligen Bettgenossinnen gewesen, so eine wie sie hätte ich niemals vergessen.