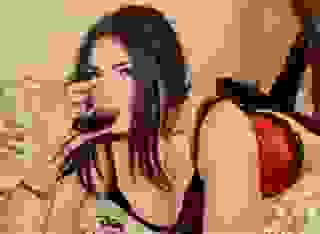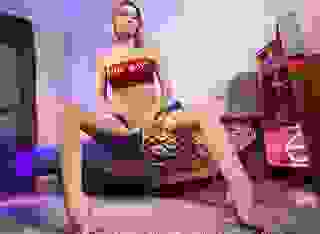Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hierFisher warf ein: „Ich will unser nettes Geplauder ja nicht unterbrechen, aber hier wartet noch ein Container darauf, ausgepackt zu werden. Laut Inventarliste sind da die Pressluftflaschen, die restlichen Laborgeräte und deine angeforderten Medikamente drin, Claire. Das räumt sich nicht von alleine aus und wenn wir heute noch fertig werden wollen, müssen wir uns sputen. Wir müssen pünktlich in See stechen. Die Uni kann es sich nicht leisten, eine weitere teure Nacht am Liegeplatz im Hafen zu finanzieren."
„Geht klar, Chef", sagte Claire.
„Gut. Julia, du kommst mit mir. Wir bringen die Laborausrüstung an ihre vorgesehenen Plätze. Claire, fang doch schon mal mit deinen Medikamenten an. Melina müsste jeden Augenblick kommen und soll dir dann dabei helfen. Um die Pressluftflaschen kümmern wir uns dann zum Schluss alle gemeinsam."
Durch stummes Kopfnicken signalisierten die beiden Frauen, dass sie mit dem Vorgehen einverstanden waren.
„Habe ich da gerade meinen Namen gehört?", flötete eine weitere fröhliche Frauenstimme. Melina hatte soeben das Deck erklommen und gesellte sich zu den drei anderen.
„Melina!", sagte Julia erfreut.
„Hey, Julia", antwortete Melina gut gelaunt und begrüßte die rothaarige Doktorandin sogleich mit einer stürmischen Umarmung. „Wenn das mal nicht meine neue Zimmergenossin ist. Das wird bestimmt cool."
Julia erwiderte die Umarmung und kicherte: „Ich freue mich auch schon darauf."
Melina löste sich von ihr und wandte sich dann an Fisher: „Wenn's dir nichts ausmacht, dann hilf du doch Claire. Julia und ich kümmern uns um die Laborausrüstung. Dann können wir beiden Mädels schon mal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Schließlich werden wir uns bald ein Zimmer miteinander teilen und sollten uns dafür ein bisschen näher kennengelernt haben."
Fisher lachte auf. „Von mir aus. Wenn Julia nichts dagegen hat?"
„Ganz bestimmt nicht", entgegnete die Angesprochene.
„Dann soll es so sein." Fisher drückte Melina eine Liste in die Hand. „Da steht alles drauf. Was wo hin kommt und so weiter. Stellt die Geräte erst mal nur in die Labore. Um das Anschließen kümmert sich dann unser Labortechniker. Auf den Verpackungen stehen die Inventarnummern drauf. Dann wisst ihr, was drin ist und wo es hinkommt."
„Geht klar!"
„Also gut", sagte Fisher, „Claire, dann gehen wir mal und kümmern uns um deine Reiseapotheke. Hast du die Liste?"
„Mist", sagte Claire, „die liegt noch auf der Krankenstation. Ich geh sie schnell holen."
„Warte, ich komme gleich mit", sagte Fisher, „ich kann euch zwei doch allein lassen, oder?"
Julia und Melina nickten unschuldig.
„Aber logisch. Auf uns beide ist Verlass, stimmt's?"
„Stimmt genau!"
„Na dann." Der Professor verschwand mit Claire im Schlepptau im riesigen Aufbau des Schiffes und ließ die beiden Mädchen allein auf dem Deck zurück.
„Also gut", sagte Melina, „dann lass uns mal anfangen." Sie deutete auf den Karton in der vordersten Reihe. „Kannst du mir die Inventarnummer nennen, Julia?"
Julia schaute sich den Karton genauer an, dann fand sie eine Reihe von scheinbar willkürlichen Ziffern. „Meinst du die da?", fragte sie.
„Ja, genau."
„Sieben-Acht-Zwo-Sieben-Vier-Drei."
Mit dem Finger suchte Melina auf der Liste, die Fisher ihr gegeben hatte, nach der von Julia genannten Inventarnummer. „Ah ja, hier ist es. Da ist ein Thermocycler für die PCR drin. Das kommt in Labor A. Siehst du zufällig die Sieben-Acht-Zwei-Vier-Vier?"
„Ja. Steht direkt daneben."
„Okay. Laut Liste ist da eine Tisch-Zentrifuge drin, ebenfalls für Labor A. Ich schlage vor, wir kümmern uns als erstes um die zwei Dinge."
Jede von ihnen nahm einen der beiden Kartons. Da Julia noch nicht wusste, wo sich Labor A befand, folgte sie einfach Melina, die sich an Bord schon gut auszukennen schien.
„Und, hast du schon alle kennengelernt?", fragte Melina neugierig, während die beiden die Kisten durch den Hangar schleppten, den Julia schon von ihrem ersten Besuch her kannte. Von dort aus ging es durch ein Stahlschott in einen der vertrauten engen Gänge, von dem rechts und links jeweils massive Türen abzweigten, in die auf Augenhöhe kreisrunde Glasfenster eingelassen waren und die einen Blick ins Innere ermöglichten. Der Laborkomplex.
„Ja", sagte Julia. „Scheinen alle ganz nett zu sein. Nur McKenna kann mich nicht leiden."
„Nicht?", fragte Melina überrascht. „Okay, er ist ein bisschen altmodisch, aber ich finde ihn eigentlich ganz nett. Und vor allem ziemlich sexy."
„Ich glaube nicht, dass er viel von mir hält." Julia zögerte, dann sagte sie: „Er hat mich ‚Bloody Squarehead' genannt. Was auch immer das bedeutet."
Melina rollte mit den Augen. „Glaub mir, das willst du gar nicht wissen."
Sie gingen in das erste Labor gleich auf der linken Seite. Auf der Tür prangte das internationale Zeichen für Biogefährdung. Darunter standen in dicken, schwarzen Lettern die beiden Worte: „GENTECHNISCHER ARBEITSBEREICH". Direkt neben der Tür war ein Schildchen angebracht, auf dem „Labor A -- S1-Bereich" stand.
Das Labor war eingerichtet wie Julia es erwartet hatte. Im Prinzip sah es wie jedes andere Labor der Sicherheitsstufe S1 auf der Welt aus, nur dass es in seinen Dimensionen insgesamt etwas beengter, beinahe klaustrophobisch wirkte. Der Fußboden bestand aus leicht zu reinigendem und strapaziösem Linoleum und schien auf Hochglanz poliert zu sein. Julia meinte, sich darin beinahe spiegeln zu können.
In Längsrichtung zur Tür standen parallel zueinander drei Arbeitsbereiche, die voneinander durch Trennwände aus Plexiglas voneinander abgetrennt waren, in die auch die Elektrik eingebaut war. Aus den Wänden ragten jeweils rechts und links und noch einmal in der Mitte je drei Steckdosen für allerlei elektrische Geräte hervor. Den Abschluss eines jeden Arbeitsbereichs bildete an der Stirnseite jeweils ein Waschbecken, das zusätzlich mit einer Augendusche ausgestattet war. Direkt über der Ein- und Ausgangstür gab es zudem eine große Dusche, Feuerlöscher, Löschdecke und einen Notschalter. Im Raum roch es nach steriler Laborluft. Direkt neben der Eingangtür verlief an der Wand in Querrichtung noch ein weiterer Arbeitsbereich. Genau für diesen waren die Geräte bestimmt, die Melina und Julia trugen.
„Die stellen wir erst mal dort hin", sagte Melina.
„Ist in Ordnung."
Laut Liste sollte in dieses Labor auch noch ein Sequenziergerät der dritten Generation gehören, das sich vermutlich noch im Container auf dem Arbeitsdeck befand. Vermutlich, so glaubte Julia, wurde dieses Labor vorwiegend für molekularbiologische Untersuchungen genutzt. Anscheinend wurden hier aus den gesammelten Proben genetische Proben isoliert, gereinigt, amplifiziert und schließlich entschlüsselt, um mit den erstellten Gensequenzen anschließend komplizierte Computeralgorithmen zu füttern. Diese konnten aus der Fülle von Daten, endlos langen Reihen bestehend aus den Buchstaben A, T, G und C, anschließend zum Beispiel phylogenetische Stammbäume erstellten. Die Buchstaben standen für jeweils eine Nukleotidbase: Adenin, Thymin, Guanin oder Cytosin, jene geheimnisvollen Bausteinene, aus denen die DNA, die Erbinformation, zusammengesetzt war und deren Reihenfolge all die Geheimnisse des Lebens enthielt. Auf der rechten Seite standen eine Impfbank, ein Brutschrank und ein Kühlschrank, um Proben zwischenlagern zu können. Dann fiel Julia auf, dass auf der linken Seite eine weitere Tür eingelassen war, die in einen separaten Raum führte.
„Der Raum da", Melina zeigte auf genau diese Tür, „ist direkt mit dem Arbeitsdeck verbunden. Von dort aus werden die gesammelten Proben gleich gesichtet und taxonomisch vorsortiert und alles, was nicht gleich an Bord analysiert werden soll, wird konserviert und ordentlich beschriftet. Die gesammelten Proben werden dann beim nächsten Landgang an Land gebracht und direkt in die Sammlung der Universität geschickt, wo sie irgendwann einmal bearbeitet werden."
Julia wusste, dass dies ganz schön lange dauern konnte. Die erste deutsche Tiefseeexpedition, die legendäre Valdivia-Expedition, war im Jahr 1898 gestartet und hatte über neun Monate lang unter der Leitung des Leipziger Zoologen Carl Chun in den Weltmeeren alles gesammelt, was man vom dunklen Grund des Meeres nach oben holen konnte. Soweit Julia wusste, waren bis heute noch nicht alle der damals aus den Tiefen des Meeres geborgenen Schätze bearbeitet. Zahlreiche in Alkoholgefäßen konservierte Fische, Muscheln, Krebstiere, Würmer und andere Kreaturen warteten noch darauf, von einem eifrigen Forscher beschrieben zu werden und zweifelsohne befanden sich darunter auch noch einige Geschöpfe, die der Wissenschaft bis heute noch gänzlich unbekannt waren.
Das Arbeiten mit Melina machte, wie Julia erwartet hatte, richtig Freude. Die beiden Frauen verstanden sich auf Anhieb prächtig miteinander und waren innerhalb kürzester Zeit ein eingespieltes Team. Melina arbeitete schnell, effizient und gewissenhaft und so hatten die beiden schon nach gut einer Stunde den Großteil des Containers in die Labore geschafft. Melina hatte Julia dabei von ihrer Arbeit erzählt, über die sie ihre Doktorarbeit schreiben würde. Die Begeisterung der jungen Biologin für die gefiederten Tiere war in jedem ihrer schwärmenden Worte zu spüren. Melina war eine richtige Vogelnärrin und diese Begeisterung war wirklich ansteckend. Schließlich hatten die beiden es geschafft und die letzte Kiste in eines der Labore gebracht. Der Professor und die Schiffsärztin waren ebenfalls gerade fertig geworden und nun machten sie sich zu viert an das Schleppen der schweren Pressluftflaschen und der übrigen Tauchausrüstung.
„Na, seid ihr denn schon bereit für euren ersten Tauchgang?", fragte Fisher.
„Bereit ist das falsche Wort, glaube ich. Gespannt trifft es wohl eher. Ehrlich gesagt liegt mein letzter Tauchgang schon eine ganze Weile zurück", gestand Julia ein.
„Macht nichts. Die neuen an Bord kriegen auf Lady Elliot Island von mir noch mal einen Auffrischungskurs. Vorher stehen eh noch keine Tauchgänge auf dem Plan."
„Die neuen?"
„Ja, du, Melina und unser Fotograf."
„Fotograf?", fragten Julia und Melina unisono. Anscheinend wusste auch die Vogelforscherin noch nichts von einer weiteren Reisebegleitung.
„Habe ich euch das noch nicht erzählt? Wir bekommen Besuch. Ein Naturfotograf wurde von der Uni ausgewählt, unsere Arbeit an Bord in ein paar schönen Bildern fest zu halten. Die Universitätsleitung ist der Meinung, dass ein Bildband über unsere Forschung ein wertvoller Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit wäre und obendrein auch recht gewinnbringend sein dürfte. Also haben sie mir kurzerhand mitgeteilt, dass ein junger, bislang noch sehr unbekannter, aber wohl recht talentierter Naturfotograf uns begleiten wird."
„Und wer ist dieser Typ?", fragte Melina interessiert.
Achselzuckend antwortete Fisher: „Keine Ahnung. Ich habe ihn selbst noch nicht kennengelernt. Aber er ist wohl ein Deutscher, genau wie du, Julia." Fisher warf einen kurzen Blick auf seine sportlich wirkende Armbanduhr. „Eigentlich hätte er schon längst hier sein sollen", antwortete Fisher ratlos.
„Vielleicht steckt er im Stau?", fragte Melina. „Als ich vorhin ankam, erzählten sie im Radio, dass es in der Nähe des Hafens einen Autounfall gegeben habe und alle Umleitungen ziemlich verstopft seien."
„Könnte möglich sein."
Plötzlich ertönte aus der Ferne eine laute und leicht hilflos klingende Stimme. „Prof. Fisher, sind Sie hier?" Offenbar ein Mann.
Die vier blickten gespannt von der Reling des Arbeitsdecks nach unten und tatsächlich, am Kai stand, von hier oben aus beinahe ameisenhaft klein wirkend, eine Männergestalt, neben sich zwei riesengroße und schwer wirkende Rollkoffer stehend.
„Sind Sie unser Fotograf?", fragte Fisher nach unten.
Der junge Mann hielt seine Hände vor seinen Mund und formte sie zu einem Trichter. Laut schrie er nach oben: „Ja, der bin ich." Er sprach mit einem ziemlich starken deutschen Akzent und klang als wäre er ziemlich außer Puste. „Sind Sie David Fisher?"
„Ja, der bin ich. Warten Sie, ich komme runter zu Ihnen und helfe Ihnen bei Ihren Koffern."
Mit schnellen Schritten eilte Fisher zum Fallreep und verschwand bald darauf aus dem Blickfeld der drei Frauen.
„Wusstest du etwas davon?", fragte Melina neugierig die Schiffsärztin.
„David hat's mir auch gerade erst erzählt", antwortete Claire. „Offenbar wohl wirklich ein Passagier in letzter Minute."
Wenig später tauchte wieder Fishers Kopf auf, als dieser die Gangway nach oben gestapft kam. Bald darauf wurde auch der Rest seines Körpers wieder sichtbar. In der Hand hielt er einen ziemlich schweren Koffer. Hinter ihm stapfte der Fotograf, ebenfalls einen schweren Koffer tragend, die Gangway herauf.
„Mädels, darf ich euch mit unserem Fotografen bekannt machen. Das ist ... "
Fisher kam nicht dazu, seinen Satz zu beenden. Als Julia das Gesicht des Unbekannten nun aus der Nähe sehen konnte, wurde sie kreidebleich. Es war gar kein Fremder. Das saphirblaue Augenpaar und die Grübchen auf den Wangen kannte sie nur zu gut. Unweigerlich klappte ihr Unterkiefer nach unten.
Ungläubig sagte sie: „ ... Florian?"
Kapitel 10: Vermisst
Ganz nervös trommelten die knochigen Finger der Frau auf den gedeckten Speisetisch. An der Wand schwang das Pendel der geschmackvollen viktorianischen Wanduhr gleichmäßig hin und her. Vor nicht ganz fünf Minuten hatte sie zur vollen Stunde geschlagen. Lydia Singer seufzte laut hörbar auf. Das Essen war inzwischen viel zu kalt. Der Wein viel zu warm.
Lydia fuhr sich fahrig durch ihr ergrautes Haar. Bis vor zwei Jahren hatte sie aus Eitelkeit noch nachgeholfen und ihr Haar regelmäßig mahagonibraun gefärbt. Doch nun, mit neunundfünfzig Jahren, verzichtete sie darauf, denn ihr Alter ließ sich ohnehin nicht mehr verbergen. Schon seit einer ganzen Weile war ihr Bindegewebe nicht mehr so fest wie früher, alles hing ein bisschen und auch so rank und schlank wie einst war sie nicht mehr. Fältchen überzogen ihr trotz des gesetzteren Alters immer noch sehr hübsches Gesicht wie feine Linien auf einer Landkarte. Zumeist waren es unbekümmerte Lachfalten. Im Augenblick waren es jedoch Sorgenfalten.
Beruhigend nahm ihre Tochter Lucie ihre Hand. „Es wird schon nichts passiert sein", sagte sie. Doch Lydia sah ihrer Tochter nur sorgenvoll ins Gesicht. Lucie sah aus wie eine jüngere Ausgabe ihrer Mutter. Schlank, feine Gesichtszüge, dunkelbraunes Haar und einen winzigen Leberfleck auf ihrer rechten Schulter tragend.
„Das ist überhaupt nicht typisch für Donald", sagte die alte Dame.
„Bestimmt hat Dad wieder mal nur Zeit und Raum vergessen. Du weißt doch, wie sehr er immer in seine Arbeit vertieft ist."
„Ich habe ihn angerufen, Schatz", meinte Lydia kopfschüttelnd. „Er sagte, er würde nur noch fünf Minuten benötigen."
„Na, da haben wir es doch. Du weißt doch, dass ‚fünf Minuten' für Vater ein sehr dehnbarer Begriff ist."
Normalerweise hätte Lydia ihrer Tochter recht gegeben, denn wenn Donald einmal in seine Arbeit vertieft war, vergaß er nur allzu leicht jegliches Gefühl für Zeit und Raum. Aber nicht heute. Am Telefon hatte es sich wirklich so angehört, als müsse er nur noch nach den Autoschlüsseln greifen.
„Nein", sagte sie mit sorgenvoller Stimme, „da muss etwas passiert sein. Vielleicht gab es einen Autounfall und er steckt im Stau fest."
„Dann hätte er doch bestimmt angerufen und bescheid gegeben."
„Und wenn er selbst einen Autounfall hatte und schlimm verletzt ist?
„Willst du etwa in jedem Krankenhaus der Stadt anrufen und fragen, ob Dad eingeliefert worden ist?"
Achselzuckend antwortete Lydia: „Ich denke schon, was bleibt mir denn anderes übrig?"
„Das ist nicht dein ernst!", maulte Lucie vorwursvoll.
„Doch!", sagte Lydia bestimmt. „Schatz, reich mir doch bitte mal das Telefonbuch."
„Das sind doch viel zu viele Nummern", schaltete sich Lucies Verlobter Jamie ein, der sich aus dem Mutter-Tochter-Gespräch bislang herausgehalten hatte. „Es würde viel zu lange dauern, sämtliche Krankenhäuser der Stadt abzuklappern, ohne irgendeinen Anhaltspunkt."
„Er hat recht, Mum", sagte Lucie. „Das würde ewig dauern."
„Aber mir bleibt doch gar keine andere Möglichkeit als es wenigstens zu versuchen!"
„Willst du nicht doch noch wenigstens eine oder zwei Stunden warten, ehe du die Pferde scheu machst?"
Aber Lydia hörte nicht auf ihre Tochter. Sie stand auf und holte sich das Telefonbuch selbst, blätterte die Seiten durch und ignorierte jeden Einwand ihrer Tochter oder ihres zukünftigen Schwiegersohnes.
Lucie seufzte resignierend auf und sagte: „Na schön, du gibst ja doch keine Ruhe. Komm, wir teilen uns die Nummern auf. Jeder von uns telefoniert ein Drittel durch -- du mit dem Festnetz, wir beide mit unseren Handys. Dann geht es schneller."
Lydia lächelte dankbar. Lucie schüttelte verärgert über sich selbst den Kopf. Wieder einmal hatte sie nachgegeben. Himmel, konnte Mutter stur sein!
Eine halbe Stunde später legte Jamie frustriert auf. „Das war das letzte Krankenhaus auf meiner Liste. Es wurde niemand eingeliefert, der auf die Beschreibung passen würde, geschweige denn den Namen Donald Singer trägt."
„Dito", sagte Lucie. „Ich habe jetzt alle Nummern durch, nirgendwo ist Dad eingeliefert worden."
Auch Lydia hatte kein Glück gehabt. In keinem Krankenhaus der Stadt war ihr Mann als Patient aufgenommen worden.
„Das ist ein gutes Zeichen, Mum", sagte Lucie und tätschelte ihrer Mutter liebevoll die Schulter, „es bedeutet, dass Dad keinen Unfall hatte. Also ist bestimmt nichts Schlimmes passiert."
„Aber ich mache mir trotzdem Sorgen", sagte Lydia. Sie griff erneut zum Telefon. „Ich rufe jetzt die Polizei!"
„Aber was willst du denen denn erzählen? Dass Dad ein paar Stunden zu spät zum Sonntagsessen gekommen ist? Die werden dich doch nur auslachen, Mum."
„Ist mir egal. Ich muss irgendetwas tun, sonst werde ich noch verrückt." Lydia tippte schnell die Notrufnummer der Polizei ins Telefon ein und wartete darauf, dass die Verbindung hergestellt wurde.
*******
Wenn nur diese verdammten Kopfschmerzen nicht wären, die sie schon den ganzen Tag über quälten. Constable Annie Blackthorne strich sich eine Strähne ihres honigblonden Haares aus dem Gesicht und starrte müde auf die Uhr. Es war definitiv keine gute Idee gewesen, sich am Vorabend auf das Date mit ihrem Kollegen einzulassen. Alles, was sie nun davon hatte, waren der schale Nachgeschmack eines unbefriedigenden One Night Stands mit einem Arbeitskollegen, der seine Qualitäten im Bett maßlos übertrieben hatte und ein brummschädelerzeugender Kater von dem Absacker, den sie anschließend in der Polizistenbar noch zu sich genommen hatte, um die letzten Stunden aus ihrem Gedächtnis zu streichen.
Annie stöhnte. Noch immer waren knapp eineinhalb Stunden ihrer Schicht zu bewältigen. Unliebsamer Telefondienst auf der Wache.
Hoffentlich würde das Arbeitsklima nicht unter ihrem nächtlichen Fehltritt leiden. Wie hatte sie auch nur so unvernünftig sein und sich auf dieses blöde Techtelmechtel einlassen können? Hätte sie es nicht besser wissen müssen? Immerhin war sie doch kein hormongesteuerter pubertierender Teenager mehr, sondern Mitte zwanzig. Eine Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben stand. Die normalerweise ganz genau wusste, was sie wollte. Im Augenblick wollte sie nur dieses höllische Dröhnen in ihrem Kopf loswerden.
Verdammt, ich werde nie wieder mit einem verdammten Kollegen vögeln, schwor sie sich, während sie eine Kopfschmerztablette aus einem Blister drückte. Stechender Schmerz durchzuckte ihre Schläfen. Und ich werde keinen Tropfen Alkohol mehr anrühren.
Wenigstens war sie so vernünftig gewesen und hatte auf ein Kondom bestanden. Eine ungewollte Schwangerschaft hätte ihr jetzt gerade noch gefehlt, wo sie so kurz vor der Beförderung stand.
Das Klingeln des Telefons riss sie aus ihren Gedanken. Hastig warf sie sich die Tablette ein, spülte sie mit einem Schluck stillem Wasser herunter und nahm über ihr Headset das Gespräch entgegen.