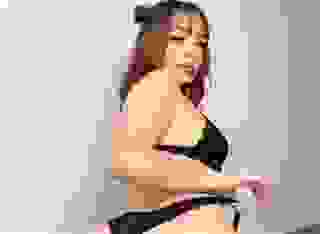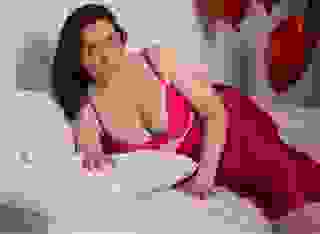Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hier„Queensland Police, Revier 23, Sie sprechen mit Constable Annie Blackthorne, was kann ich für Sie tun?", meldete sie sich ziemlich gelangweilt.
„Hallo", sagte eine Frau am anderen Ende der Leitung. Sie schien ganz nervös und aufgekratzt zu sein. „Hier spricht Lydia Singer. Ich möchte meinen Mann als vermisst melden, Donald Singer."
„Einen Moment bitte, Ma'am." Annies Finger huschten klappernd über die Tastatur ihres Desktoprechners, um das entsprechende vorgefertigte Formular für Vermisstenanzeigen aufzurufen. „Sie wollen Ihren Mann als vermisst melden, ist das richtig?", fragte sie noch einmal höflich nach. Sicher ist sicher, nicht dass sie die andere Gesprächsteilnehmerin in ihrem verkaterten Zustand falsch verstanden hatte.
„Ja, genau. Er ist verschwunden und das sieht meinem Donald überhaupt nicht ähnlich. Wenn ihm etwas passiert ist ... ", sprudelte es aus der älteren Dame heraus.
„Beruhigen Sie sich erst einmal Ma'am. Seit wann ist Ihr Mann denn verschwunden?", fragte Annie.
„Heute Vormittag habe ich noch mit ihm telefoniert. Er arbeitet in der Universität, wissen Sie? Mein Mann ist Professor für Geschichte und ... ach, das wird Sie bestimmt nicht interessieren, Constable ... " Die Frau, Annie schätzte sie dem Timbre ihrer Stimme nach zu urteilen auf irgendetwas zwischen Ende fünfzig und Anfang siebzig ein, hatte recht -- es interessierte sie wirklich nicht. „Jedenfalls ist Donnie heute früh in sein Büro gefahren, um Klausuren zu korrigieren. Als ich ihn gegen zehn anrief und daran erinnerte, dass unsere Tochter heute vorbei käme und er sich beeilen solle, um pünktlich zum Mittagessen da zu sein, meinte er, dass er sich sofort auf den Weg machen würde, aber er ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht."
„Ma'am, Ihr Mann ist erst seit heute Mittag verschwunden?", fragte Annie und verdrehte die Augen.
„Ja, das ist richtig."
„Ma'am, wir können eine Vermisstenanzeige erst aufnehmen, wenn die gesuchte Person mindestens vierundzwanzig Stunden lang verschwunden ist", erklärte Annie.
„Aber", sagte Lydia konsterniert, „das sieht Donnie überhaupt nicht ähnlich. Da muss doch etwas passiert sein!"
„In den allermeisten Fällen taucht eine vermisste Person innerhalb eines Tages wieder wohlbehalten auf, Ma'am", antwortete Blackthorne routiniert professionell. Eine Antwort, die zwar keinen Trost spendete, in der Regel aber der Wahrheit entsprach.
Eine lange Pause entstand, in der nur das knisternde Rauschen der Leitung zu vernehmen war.
„Ma'am, sind Sie noch dran?", fragte Annie.
„Hören Sie", sagte Lydia schließlich ärgerlich, „Sie sind doch die Polizei, oder nicht?"
„Das ist richtig." Natürlich waren sie die Polizei. Und die hatte schon genug mit richtigen Fällen zu tun. Die Beamten konnten sich doch nicht mit solchen Dingen beschäftigen wie alten Ehemännern, die ein paar Stunden zu spät zum Essen kamen. Annie zuckte ratlos mit den Schultern. Vielleicht waren die Kochkünste der Anruferin derart schlecht, dass ihr Mann sich lieber in einer Kneipe ein ordentliches Essen gegönnt und dabei die Zeit vergessen hatte.
„Sie müssen den Bürgern helfen! Dann tun Sie gefälligst Ihre Pflicht und helfen mir, meinen geliebten Donald zu finden", sagte Lydia bestimmt.
„Wie ich Ihnen bereits sagte, Ma'am, müssen wir zunächst einen Tag lang warten, ehe wir eine Vermisstenanzeige aufnehmen können."
„Aber dann könnte es doch schon viel zu spät sein!", schimpfte Lydia laut.
„Hören Sie", sagte Blackthorne, „ich verstehe, dass Sie besorgt sind. Aber ich kann Ihnen leider nicht helfen, wenn es nicht klare Anzeichen dafür gibt, dass Ihr Mann in ernsthafter Gefahr schwebt oder Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte. Wir müssen wirklich bis morgen warten, bis wir weitere Schritte unternehmen können."
„Bitte, helfen Sie mir doch!", flehte Lydia einem Heulkrampf nahe.
„Okay, Mrs Singer, so war doch Ihr Name, richtig? Leidet Ihr Mann vielleicht unter irgendeiner chronischen Erkrankung. Diabetes vielleicht? Irgendetwas, das es rechtfertigen würde, nach ihm auch ohne den konkreten Verdacht auf eine Straftat zu suchen?"
„Nein, mein Donald ist kerngesund. Na ja, ein bisschen Arthritis vielleicht und er braucht eine Lesebrille. Die üblichen Leiden des Alters. Aber ansonsten ist mein Mann topfit."
„Dann fürchte ich, dass ich nicht viel für Sie tun kann, Ma'am. Wenn Ihr Mann bis morgen nicht wieder aufgetaucht ist, können Sie noch einmal anrufen."
„Bitte, Constable Blackthorne. Ich glaube wirklich, dass Donald etwas zugestoßen sein muss. Er ist ein sehr gewissenhafter Mann und würde niemals das Sonntagsessen verpassen. Wissen Sie, unsere Tochter ist extra aus Sydney angereist, um uns unseren zukünftigen Schwiegersohn vorzustellen. Donald hätte das nie im Leben einfach so verpasst. Bitte, helfen Sie mir."
Blackthorne seufzte auf. „Na schön", sagte sie resignierend. Sie wusste schon in diesem Augenblick, dass sie das noch bereuen würde. Sie würde zum Gespött auf dem ganzen Revier werden. Sie hörte schon, wie ihre Kollegen gackerten: Ernsthaft? Du nimmst eine Vermisstenanzeige auf, ohne jeden hinreichenden Anfangsverdacht? Warum? Weil die Stimme einer alten Frau am Telefon so mitleiderregend geklungen hat?
„Hören Sie, ich kann im Moment noch keine offizielle Vermisstenanzeige aufnehmen", sagte Annie. „Aber wenn Sie mir Ihre Adresse geben, kann ich nach Dienstende bei Ihnen vorbei schauen und Sie erzählen mir ganz genau, was passiert ist und geben mir eine Personenbeschreibung, okay?"
„O ... okay", stammelte Lydia erleichtert auf, „haben Sie vielen Dank, Constable Blackthorne."
Annie zog eine Augenbraue hoch. Das würde sie vermutlich noch tief bereuen. Sie lehnte sich wirklich weit aus dem Fenster. „Also gut", sagte die junge Polizistin, „ich bin in ... einer Stunde bei Ihnen, ja? Könnten Sie mir eventuell bis dahin ein möglichst aktuelles Foto von Ihrem Mann heraussuchen? Und bitte überlegen Sie genau, welche Kleidung Ihr Mann trug, als Sie ihn zum letzten Mal gesehen haben."
„Das mache ich. Haben Sie nochmals vielen Dank, Constable."
Die Polizistin legte auf. Dann schickte sie ein Stoßgebet gen Himmel und rieb sich müde ihre schmerzenden Schläfen. Hoffentlich hatte sie keinen Fehler gemacht.
Kapitel 11: Aufbruch
Der Brisbane River schlängelt sich in der City von Brisbane nordwärts an einer kleinen Halbinsel vorbei, auf der sich der botanische Garten der Stadt befindet. Von dort aus mäandert der träge Fluss noch gut siebenunddreißig Kilometer weiter nach Osten, wo er schließlich in der Moreton Bay ins Meer mündet. Der Hafen von Brissie, offiziell Port of Brisbane genannt, befindet sich in unmittelbarer Nähe zum internationalen Flughafen auf Fisherman's Island, einer künstlich aufgeschütteten Insel im Mündungsbereich des Flusses, die vom Festland aus über zwei Brücken zu erreichen ist. Die weitläufigen Hafenanlagen erstrecken sich über weit mehr als dreihundert Hektar Fläche und in den vergangenen Jahren hat sich der Port of Brisbane zu einem der am schnellsten wachsenden und bedeutendsten Containerhäfen des ganzen Landes entwickelt. Der Hafen war gewissermaßen Queenslands wirtschaftliches Tor zur Welt. Von hier aus wurden wichtige Importgüter ein- und andere Güter, etwa Stahl und Zuckerrohr, ausgeführt.
Die Sonne hing schon dicht über dem Horizont; eine große, glutrote Scheibe, die im Westen über den in der dunstigen Ferne verschwommen flimmernden Gipfeln der Great Dividing Range hing, ein selbst an den höchsten Stellen nur wenig mehr als tausend Meter hohes Gebirge, das sich beinahe einmal komplett von Nord nach Süd entlang der Ostküste des flachsten aller Kontinente erstreckte und dabei dem Küstenverlauf teilweise nur wenige Kilometer landeinwärts folgte. Bei Brisbane machte der Höhenzug einen Schlenker nach Osten in Richtung Küste, sodass die Stadt im Norden und Nordosten halbmondförmig von den Bergen eingerahmt wurde. Die Kuppen des Gebirges schienen im Licht der untergehenden Sonne zu verglühen -- sicher nicht ganz so spektakulär wie vielleicht in den europäischen Alpen, aber immer noch ein atemberaubend schöner Anblick. Der feuerrote Ball berührte gerade den Horizont, als die Argo zum Leben erwachte.
Julia stand allein an der Reling und spürte das kräftige Beben des Stahlkolosses, als die riesigen Dieselmotoren angeworfen wurden und ihre Arbeit aufnahmen. Sie spürte, wie das Metallgerüst der Reling in ihren Händen vibrierte. Ein letztes Mal blickte Julia auf die Stadt zurück, doch es kam ihr eher vor als werfe sie einen letzten Blick auf ihr vergangenes Leben. Ein Abschied für immer von einer Julia, die ein Leben gelebt hatte, das es nicht mehr gab. Nicht ganz, wurde ihr schlagartig klar. Reflexartig zuckte ihre rechte Hand zu dem Bernsteinring an ihrem linken Ringfinger, berührte ihn mit ihren Fingerkuppen. Das letzte Erinnerungsstück, das sie nun noch mit ihrem alten Leben verband.
Ruckartig nahm die Argo Fahrt auf. Sie sah, wie die Schiffsschrauben das brackige Wasser des Hafens kräftig durchrührten und zum Schäumen brachten. Träge und langsam entfernte sich das Schiff von der Kaimauer. Allmählich wurde die Argo schneller und Julia sah zu, wie die Umrisse der Stadt bald kleiner wurden und sich immer weiter entfernten, obwohl natürlich streng genommen sie es war, die sich mitsamt dem Schiff von den Häusern entfernte.
Während Julia dabei zusah wie ihr altes Leben langsam aber stetig davonglitt, schweiften ihre Gedanken zu ihrem zukünftigen Leben ab. Was es wohl bringen mochte? Eines war jedenfalls sicher, es fing schon einmal prima an.
Ein dicker, schwerer Stein bildete sich in ihrer Magengegend als sie an die große Überraschung des Nachmittags denken musste. Florian war der ominöse Fotograf, der sie während der gesamten Reise begleiten würde -- ausgerechnet die Person, mit der sie am allerwenigsten auf einem Boot, umgeben von nichts als Wasser, sein wollte. Wut stieg in ihr auf und unweigerlich klammerten sich ihre Hände fester um die Reling, bis die Knöchel weiß hervortraten.
Verdammter Arsch!, dachte sie, Wieso muss ausgerechnet der dieser bescheuerte Fotograf sein?
„Herr im Himmel", fluchte sie leise, obwohl sie keineswegs gläubig war, „was um alles in der Welt habe ich dir denn getan, dass du mich derart abstrafst? Hab' ich denn nicht wirklich schon genug durchmachen müssen? Erst nimmst du mir die Liebe meines Lebens und jetzt sperrst du mich mit diesem Vollarsch auf dieser gottverdammten Nussschale ein!"
Insgeheim, so hatte Julia die Vermutung, musste Gott, falls es ihn wirklich geben sollte, wohl aus irgendeinem Grund eine perverse Freude dabei empfinden, wenn er die Menschen leiden sehen konnte.
Das Schiff durchquerte die Moreton Bay nun mit konstanter Geschwindigkeit. Die Küstenlinie wurde immer kleiner und kleiner, bis sie nur noch ein ferner Streifen am Horizont war. Zu ihrer Linken tauchte nun die Silhouette einer Insel auf.
St. Helena Island. Sie war eine von gut dreihundertfünfzig geschützt in der pazifischen Bucht liegenden Inseln, von denen die bekannteste Insel Moreton Island war, die im Augenblick aber noch irgendwo weiter nördlich außer Sichtweite lag.
St. Helena war ein kleines, ja geradezu winziges Inselchen. Die untergehende Sonne beschien eine eingefallene Ruine und brachte die alten, moosbewachsenen Gemäuer zum Glühen. Es waren die Überreste einer einstigen Sträflingssiedlung wie man sie in Australien zuhauf finden konnte -- über Jahrzehnte hinweg hatten die australischen Kolonien dem britischen Empire als weit von der Heimat entfernt gelegenes, riesiges Freiluftgefängnis gedient. Beinahe jede Stadt und jede größere Siedlung auf dem australischen Kontinent war einst in ganz ähnlicher Weise als Sträflingskolonie gegründet worden. Tagsüber brachte die Fähre geschichtsinteressierte Urlauber und Besucher auf die Insel. Doch nun, wo die Ruinen verlassen waren, wirkten sie im Dämmerlicht beunruhigend gespenstisch.
„Alles okay?", fragte plötzlich David Fisher. Julia hatte gar nicht gemerkt, dass sie nicht mehr allein war.
„Oh, hey", sagte Julia. „Ich hab' dich gar nicht kommen gehört."
„Das habe ich gemerkt. Wenn dich irgendetwas beschäftigt, kannst du jederzeit mit mir reden, das weißt du, oder?"
„Ja."
„Hör mal, wegen vorhin ... wir kriegen keine Probleme, oder?"
Julia errötete betreten als sie daran dachte, wie unmöglich sie sich vor gar nicht allzu langer Zeit benommen hatte. Als sie erkannt hatte, dass Florian der Fotograf war, war sie beinahe ausgetickt. Beschämt kehrten die nur wenige Stunden alten Erinnerungen zurück.
Auf dem Arbeitsdeck hatte gespannte Stille geherrscht, dass man eine winzige Nadel hätte auf den Boden fallen hören können. Julia hatte förmlich die neugierigen Blicke der anderen auf ihrer Haut spüren können; fühlend wie drei Augenpaare sie neugierig gemustert und dann im nächsten Augenblick zu dem Naturfotografen gewandert waren, um, bei ihm angekommen, wieder zu ihr zurück zu wandern. Wie sie wie ein Pendel zwischen ihr und ihm hin und her geschwungen waren.
Sie erinnerte sich, wie der Professor sich verlegen geräuspert hatte. „Ihr ... ähm ... ihr kennt euch?", hatte sein hüstelnder Kommentar gelautet.
„Kann man wohl sagen", hatte sie bedrohlich gezischt, während ihre Kiefer mahlten.
Instinktiv waren alle einen Schritt zurück gewichen als hätten sie befürchtet, sie würde im nächsten Augenblick Gift sprühen wie eine zornige Speikobra.
„Was, um alles in der Welt, machst du hier?", hatte Julia gefaucht und Florian einen verächtlichen Wenn-Blicke-töten-könnten-Blick zugeworfen.
Anstatt zu antworten, hatte er mit einer Gegenfrage entgegnet: „Was, zum Teufel, machst du hier?" Seine gereizte Stimme hatte unmissverständlich klar gemacht, dass er sich nicht von ihr in die Defensive treiben lassen würde.
„Das sieht man doch wohl", hatte sie zurückgegiftet und dabei die Augen verdreht, „ich arbeite hier. Oder übersteigt das deinen ziemlich beschränkten Verstand?"
„Schön, ich arbeite nämlich auch hier", hatte Florian geantwortet.
„Das geht nicht!"
„Und ob das geht."
„Nein!"
„Und warum nicht?"
„Weil ich dich Blödmann sonst eigenhändig über die Reling werfe und im Meer versenke."
Florian hatte laut aufgelacht. „Versuch's doch", hatte er ihr achselzuckend entgegnet. „Das schaffst du sowieso nicht."
„Wetten, dass doch?"
„Du traust dich sowieso nicht!"
Das war doch wohl der Gipfel der Frechheit! Es hatte das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht und Julia war explodiert wie eine Bombe. Sie hatte sich auf Florian gestürzt und geschrien: „Ich kratz' dir die Augen aus, du dämlicher, blöder ... "
Melina hatte als erste reagiert und war mit einem Hechtsprung hinter ihr her gelaufen und hatte sie an ihren Armen zu fassen bekommen. Sie hatte die rothaarige Furie einen Schritt nach hinten gezogen, die sich heftig zappelnd und sich wie ein Aal windend aus dem schraubstockartigen Griff der jungen Ornithologin zu befreien versucht hatte.
„Lass mich los!", hatte sie wütend geschrien.
„Das reicht jetzt!", hatte Fisher gereizt gesagt. „Ich dulde an Bord nicht solche kindischen Streitigkeiten." Sein enttäuscht auf ihr ruhender Blick hatte dazu geführt, dass sie sich augenblicklich wie ein kleines Kind, das im Supermarkt beim Klauen eines Lutschers erwischt worden war, gefühlt hatte und sie zum Innehalten veranlasst.
„Es ist mir scheißegal, was zwischen euch ist. Ich erwarte von allen an Bord, dass sie miteinander fair und kollegial umgehen und zusammen arbeiten. Wenn so etwas noch einmal vorkommen sollte, schmeiß ich euch beide im nächsten Hafen von Bord. Habt ihr mich verstanden?", hatte er gepoltert.
„Ja", war Julias kleinlaute Antwort gewesen. Sie wusste, dass sie Fisher soeben sehr enttäuscht hatte. Noch im selben Augenblick hatte sie sich zutiefst für ihr Verhalten geschämt.
„'Tschuldigung, kommt nicht wieder vor", hatte sie genuschelt, ihre Schultern demütig gesenkt.
„Das will ich schwer hoffen." Verständnislos hatte Fisher mit dem Kopf geschüttelt. „Ihr solltet froh sein, dass Kielholen heutzutage nicht mehr erlaubt ist."
Während Fisher jetzt mit ihr an der Reling stand, war ihr die Szene immer noch unendlich peinlich.
„Nein, kriegen wir nicht", antwortete Julia ihrem Chef.
„Na dann ist es ja gut. Das Abendessen ist fertig. Kommst du mit in die Messe?"
„Ist denn Florian auch dabei?", fragte Julia vorsichtig.
„Natürlich. Ist das etwa ein Problem?"
Julia wollte antworten, zögerte aber. Einen Moment zu lange.
„Das ist also ein Problem", stellte Fisher lakonisch fest. „Was ist das nur zwischen euch?"
„Es ... ist kompliziert", sagte Julia ausweichend.
Fisher spürte, dass aus Julia nicht mehr herauszuholen war und beschloss daher, es dabei zu belassen. „Es ist mir eigentlich auch egal und geht mich nichts an. Du musst ihn nicht mögen, aber lass nicht die Arbeit an Bord darunter leiden, okay?", sagte er.
Julia rang sich ein gequältes Lächeln ab. „Okay. Ich geb' mir Mühe."
„Dann komm jetzt, das Essen wird sonst kalt."
„Was gibt's denn?"
Fisher grinste breit: „Na was wohl? Vegemite natürlich!"
„Ist nicht dein Ernst?!", rief Julia entsetzt, „Schon wieder?"
Der Professor lachte laut auf. „War nur Spaß."
*******
In der Kabine war alles seelenruhig bis auf ein leises, monotones Tuckern aus dem Maschinenraum, das die großen Motoren des Forschungsschiffs von sich gaben. Die Argo glitt ruhig über die spiegelglatte vom silbrigen Sichelmond beschienene See.
Aber Julia konnte nicht schlafen. Sie fand einfach keine Ruhe, obwohl ihr Bett angenehm weich und gemütlich war. Aufgewühlt starrte sie die dunkle Zimmerdecke an und zermarterte sich den Kopf. Zu neu und überwältigend waren die Eindrücke des zurückliegenden Tages. Ihre erste Nacht an Bord war doch etwas ganz Besonderes und aufregend. Das allein war es jedoch nicht, was Julia wach hielt. Der eigentliche Grund für ihr Gedankenkarussell hieß Florian. Wie sollte sie bloß die kommenden Tage und Wochen überstehen?
Obwohl das Schiff mehr als einhundert Meter lang war, konnte es für Julias Empfinden gerade nicht groß genug sein. Julia musste daran denken, wie Fisher ihr bei ihrem ersten Besuch auf der Argo erzählt hatte, dass sie schnell feststellen würde, wie beengt das Schiff trotz seiner imposanten Erscheinung in Wahrheit war. Nie hätte sie für möglich gehalten, dass sie dem Professor so schnell zustimmen würde.
Natürlich könnte sie versuchen, Florian einfach aus dem Weg zu gehen und das Weite zu suchen, sobald er auftauchte, aber das würde nicht immer funktionieren. Zwangsläufig würden sie sich früher oder später auf dem Schiff über den Weg laufen und auch zusammen arbeiten müssen. Und dann? Was würde geschehen? Wie sollte sie sich dann verhalten?
Selbst wenn es ihr gelänge, Florian bei der tagtäglichen Arbeit aus dem Weg zu gehen, spätestens beim Essen würden sie beide miteinander in einem Raum sein und es konnte dabei nicht immer eine eisige Stille herrschen so wie heute beim Abendessen. Niemand in der Runde hatte sich getraut, auch nur irgendetwas zu sagen, nur um nicht den Zündstoff für eine weitere Gefühlsexplosion zu bieten. Alle hatten einfach geschwiegen, als hätten sie miteinander irgendein absurdes Schweigegelübde vereinbart. Die peinliche Stille während des Essens war Julia fast noch unangenehmer gewesen als ihr Emotionsausbruch am Nachmittag. Nein, so konnte es wirklich nicht weiter gehen. Irgendetwas musste passieren!
Komm schon, dachte sie, wir sind beide erwachsen. Irgendwie wirst du dich schon mit ihm arrangieren. Du musst nur professionell mit ihm zusammenarbeiten und sollst ihn ja nicht gleich heiraten.
Bei dem letzten Gedanken schnürten sich ihr die Eingeweide zu. Gott, was für eine gruselige Vorstellung! Aber es half alles nichts. Florian war, ob sie es nun wollte oder nicht, für die nächste Zeit zu einem unfreiwilligen Teil ihres Lebens geworden und sie würde sich mit der Situation arrangieren müssen.