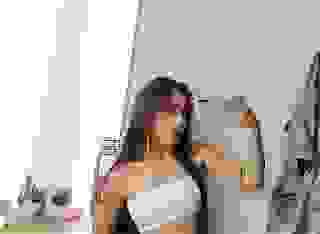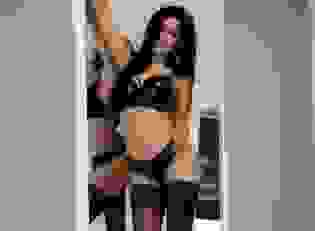- Romanze
- Das offene Herz – Pt. 02
Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hier2. Kapitel
*
Sie starb. Starb unter meinen Händen weg.
Ich war voller Blut. Ihr Blut.
Ich konnte nichts tun. Wollte ich ihr die Seile lösen, müsste ich dir Wunde ungehemmt sprudeln lassen. Genauso, um in der Sporttasche nach meinem Handy zu sehen.
Hatte ich es überhaupt eingesteckt? Und was erkaufte ich ihr davon?
Sekunden. Sekunden Zeit. Am Leben. Gefesselt. Mit mir.
Bei mir. Ich blickte hoch. Fand ihre Augen. Sie wurden schon trüb.
«Scheiße. Es tut mir so Leid.» Ich weinte. Weinte mit einem Mal hemmungslos.
Ihre Flanke war so heiß geworden, und ihr Blut war es auch. Wir dampften beide.
Ich weinte. Seltsam. Ich hatte so lange nicht mehr geweint. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann-- «
Aber war es egoistisch, jetzt an mich zu denken? Ich war doch für sie verantwortlich! Wenn es jemand war, dann ich, hier.
Sie hielt ihre Augen bereits fest geschlossen. Und erduldete.
Tat gerade das, wofür wir hergekommen waren. Übte ihre Rolle aus. Und ich meine -- Ich nahm sie ja auch. Hielt sie ja wortwörtlich in Händen und empfing sie, ihr Leben.
Ja, das waren so meine Gedanken, während die, mit der ich hergekommen war, um sie zu zerstören, unter mir auslief -- während sie einen ruhigen, tiefen Ton ausstieß, ein langgezogenes Stöhnen.
Und dabei wäre es geblieben. Ein Leben lang Schuld. Kein Knast, denn der Jagdunfall wäre ja forensisch nachweisbar: Schuld, aber keinen Vorwurf.
Nein, der Weg der Vorwürfe, der tiefere, glück- und leidvollere, eröffnete sich mir erst, als zum zweiten Mal in dieser Nacht etwas völlig unerwartetes passierte.
«Was ist hier denn los!»
Die Büsche wichen vor ihm zurück. Mit uns auf der Lichtung stand der Jäger.
Der Mond ruhte auf ihm, nur sein Alter war nicht zu erraten. Älter, das war alles, was ich zu bestimmen vermochte.
Er war über und über in Leder und dunkler Leinwand gekleidet, ein kastenförmiger Rucksack ragte bucklig weit über seinen Nacken hinaus. Spritzer von Flecktarn auf seiner Kleidung verliehen ihm etwas Soldatisches. Und an seinen Rucksack geschnallt, ihn überragend, das lange, lange Gewehr.
Kurz, sah er aus wie ein Mann, der keinen Tag seines Lebens im Haus verbrachte. Nur sein etwas schmales Gesicht hatte etwas... aristokratisches an sich.
Er war gleich bei der Sache. Warf seinen Rucksack mit der Waffe in den Dreck und fuhr mich an:
«Ich übernehme die Wunde. Du schneidest diese teuflischen Seile los!»
Und er hob ein Messer aus seinem Gürtel, das entschieden zu lang schien, um dort dringesteckt zu haben. Die Klinge war tief gezahnt. Zum Ausweiden großer Stücke -- wie dem unsrigen.
Ich zitterte, als ich es an die Taue setzte.
Aber es riss die Seile nur so runter. In plötzlicher Geistesgegenwart ließ ich die Seile intakt, die unser Mädchen unter Brustkorb und Becken hielten, während er mit dem Fuß nach dem Rucksack angelte. Indem er sich mit seinem ganzen Körpergewicht gegen seine eine Hand auf der Wunde stemmte, förderte er mit der anderen dicke Verbandspäckchen zu Tage.
Als wäre er hierauf vorbereitet gewesen -- Ein Umstand, der mir zu der Zeit noch nicht zu denken gab; später schon.
«Brust kappen!»
Jetzt umwickelte er sie konzentriert mit weißem Mull, während ich zur Hand ging und an der Wunde das Kompressionspaket fixierte.
Der Mull hob sich kaum mehr von ihrer Haut ab; sie war, wie die Hirschkuh, die sie so gemocht hatte, selber ganz weiß geworden.
Den Nylon-Body hatte der Mann ihr einfach zerrissen.
«Runter!»
Ich kappte die letzten Seile. Sie glitt zu Boden.
Sie war vollkommen leblos. War sie schon tot?
Mich packte das Grauen.
Aber der Jäger hatte bereits seinen Rucksack wieder aufgeladen, inklusive baumelndem Gewehr, seiner Mörderbüchse
«Und jetzt, Junge, bete ich, daß du trainiert hast.» raunzte er.
Er dirigierte mich hinter sich und hieß mich, ihre Beine über meine Schultern zu laden, während er ihre Arme nach vorne nahm, ihre Schultern an seine, und aufgebockt auf seinem Rucksack. Ihren Kopf stützte er mit der Hand, vorsichtig, wie man ernst einen guten Apfel hinhält.
Und dann rannten wir. Eilten durch die Waldesnacht. Stolperten durchs Unterholz; auf dem Weg beschleunigten wir unsere Schritte zu einem langen Galopp. Alldieweil mir ihre Pussy vor der Nase wippte, daß ich die von der letzten Rasur übrigen Stoppeln differenzieren konnte.
Es roch nach gar nichts, nicht einmal mehr nach Mensch roch sie. Wir verloren sie, transportierten ein Stück Stück durch diese Nacht.
Wie zwei eilige Sendboten zu einem ungeduldigen Kaiser, so unbeteiligt und verpflichtet fühlte ich mich.
‹Ihre Pussy ist ihre Schwachstelle› erinnerte ich mich reden.
Dann pochte mein Blut zu laut, um überhaupt noch etwas zu denken, oder zu hören.
*
Der Krankenwagen kam uns entgegen, blaulichternd, kam, als wir die ersten Lichter der Stadt durch die Bäume erkannten.
Wie der Kerl es geschafft hatte, in den lebensrettenden Sekunden auch noch den Rettungsdienst anzurufen, blieb mir ein Rätsel.
Sie wurde uns von flinken Händen abgenommen, eingeladen in diese brandhelle, sterile Festung und zahllos angeschlossen.
Ihren Kopf hatte der Jäger zuletzt fast widerwillig aus der Hand gegeben, und nicht bevor er ihr einen Kuss auf die Stirn mitgab.
Eine Geste, die auf mich so väterlich wirkte, daß ich es irgendwie total in Ordnung fand -- ohne, daß ich das einordnen konnte.
«Wer von Ihnen ist Familie?» blaffte uns einer der beiden Sanitäter an.
Der Alte schubste mich vor. «Geh nur», nickte er. «Ich muss nochmal raus. Es ist noch nicht vorbei.»
Dabei rollten seine Augen und er blickte wie lauschend in die Baumkronen, bis er sich umdrehte und uns verabschiedend anlächelte.
Er wartete, bis wir in den Wagen gestiegen waren. Dann schnallte er seinen Wanderstab los, der anscheinend die ganze Zeit ein Wanderstab und nie ein Gewehr gewesen war, und stand dort; bis die Türen mit den geriffelten Scheiben vor mir und Marina ins Schloss knallten.
***
3. Kapitel
*
Leuchtstoffröhre. Leuchtstoffröhre. Neon. Neon. Neon.
Sie blendeten mich noch vom schwarzen Linoleumboden, wo sie sich spiegelten. Mir war übel.
Ich hatte schon rote Fußspuren hinterlassen im Foyer. Blut verklebte mir das Hemd und ließ meine Hose knarzend an meinen Beinen pappen. Ich sah aus wie ein Monster.
Und vielleicht war ich auch eins.
Ich verfolgte eine Traube weißgewandeter Menschen und ein zwischen ihnen aufgebahrtes Mädchen, das sie mit einer Ruhe schoben, die mich wild machte.
Das Mädchen hatte ich mit einer Rute verprügeln wollen, bis ein Gewehrschuss aus dem Nichts sie vor mir rettete.
Nun lag sie da leblos. Tot, quasi. Oder nicht?
Ich versuchte, Blicke auf sie zu erhaschen, auf ihr Gesicht, oder wenigstens auf den Fuß. Aber es gelang mir nicht. Es war wie in einem bösen Traum. Immer, wenn ich glaubte, sie jetzt endlich gesehen zu haben, bogen sie um eine der unzähligen Biegungen in diesem Krankenhaus, oder ein Pfleger trat mir in den Weg und fragte mit großen Augen, wie mir zu helfen sei?!
«Nein, Nein...» murmelte ich dann, «ich bin es nicht» -- ohne zu wissen, was ich damit sagen wollte.
Und gesehen hatte ich sie immer noch nicht. Mein Körper zerbog sich von innen. Ich reckte mich, ich flüsterte -- ihren Namen? -- und nach der nächsten Biegung -- waren sie allesamt verschwunden.
Wie in einem bösen Traum. Hätte Marina aufgeblickt; was hätte sie geträumt?
Sie hätte geträumt, von einem Triebtäter durch ein Krankenhaus verfolgt zu werden, ohne Erinnerung, dorthin gekommen zu sein. Wehrlos und zu schwach in einem Krankenhausbett, viel zu langsam angeschoben von desinteressierten Gesichtern.
Und immer, im letzten Moment, bliebe ihr der Anblick ihres Verfolgers verwehrt und seiner blutüberströmten Gestalt.
Jetzt war sie in Sicherheit. Nirgends zu sehen. Wäre sie in einem Traum, wäre sie jetzt aufgewacht.
Aber vielleicht wachte sie gar nicht auf. Hatten wir zu lange gebraucht hierher?
Ich taperte noch einige Schritte blind weiter. Hilflos weiter angetrieben von -- von...
Warum hatte ich sie nochmal verfolgt? -- Okay. Aber was wartete in ihrem Gesicht auf mich, was mich sie geradezu jagen ließ, und was mich so wild machte wie ein Tier? Was suchte ich zu erhaschen? Eine Totenmaske? Ein Gefühl?
Wessen Gefühl?
Ich blieb schlagartig stehen. Fühlte in mich hinein.
Aber dort war nichts. In meiner Magengrube kreiselte ein kaltes Eisen. Sonst nichts.
Angst überkam mich. Warum war da nichts? Müsste ich nicht irgendwie... War ich ein Monster? Ich fühlte mich wie eins.
Da packten mich Hände. Zerren mich mit sich, in eine dunkle Kammer.
Es war mir egal.
Meine Kleidung verschwindet. Erst das eine, dann das andere Bein. Ein Gestalt, unklar vor dem grellgelben Türauschnitt, drückt mich an eine Liege zum Sitzen. Plastik knastert an meinem Gesäß.
Ein verschattetes Gesicht. Ich rieche sie, bevor ich sie sehe.
Marina??
Nein. Südländisch. Bolivianerin, Chilenin, Venezuela... Dorthin ging mein Schüleraustausch. Soll ichs ihr sagen? Sie scheint ohnehin abgelenkt. Von meinem nackten Körper.
Ich muss lachen. Aber es ist wird ein blödes, überlüftetes Lachen, wie unter Narkose. Es ist so absurd, was sie tut.
Aaah, fühlt sich das gut an! Ein warmnasser Schwamm auf meinem Oberarm. Sie wäscht mich.
Sie ist jung. Sie lächelt.
Als sie mir die Oberschenkel wäscht, wirkt sie konzentriert. Aber als sie sich wieder hochbeugt für meine Hände, stechen ihre -- das sehe ich trotz der Dunkelheit -- Brustwarzen durch das Pflegerhemd.
Sie mag mich. Und rubbelt frenetisch an meinen Fingernägeln.
Dann, als ich hinlänglich sauber bin, lässt sie mich sitzen. Ich friere. Das warme Wasser kühlt auf der Haut rapide ab.
Aber da ist sie schon wieder. Im schwarzen Türrahmen zu meiner Linken. Aus einer Seitenkammer hat sie ein Handtuch geholt. Es sieht groß und und weich aus.
Damit wird sie mich abrubbeln, sagen ihre Augen, in denen Lichtpunkte keimen.
Mit einem blechernen Rums öffnet sich eine ganz stählerne Schiebetür gegenüber unseres Zimmers im Flur. Ein Arzt schiebt sich durch den Spalt und schaut sich um. Er sucht mich, und findet mich, nackt und allein im Dunkeln. Er verzieht darüber keine Miene, schließt die Stahlwand hinter sich sehr fest, und tritt ein. Als seine lila Augenringe hier im Halbdunkel untertauchen, sieht er fast freundlich aus.
Er hält mir ein Klemmbrett hin. Ich schäme mich, auch nur den Arm zu heben, um es entgegenzunehmen.
«Hier, füllen Sie das aus. Ihre Freundin ist komatös. Wir melden uns.»
«Sie -- Sie ist ins Koma gefallen?»
«Noch nicht.»
Damit wendet er sich zum Gehen, hält inne, und lauscht kurz.
Dann spricht er in die Türöffnung, wie zu einem raumlosen Geist: «Maria, B26 schreit schon wieder» und geht, mit ungedämpften, müden Schritten.
Ich betrachte das Klemmbrett in meiner Hand, die offenen, fordernden Adressfelder. Aber Maria nimmt es mir aus der Hand. Sie steht wieder vor mir. Er lächelt nicht mehr, mein Geist.
Er hat Angst vor ihm.
Statt dem Klemmbrett platziert sie das Handtuch in meinem Schoß. ‹Abrubbeln? Dich? Jemals?› sagen ihre Augen.
Das schmerzt.
Sie geht.
Ich erledige den Rest selbst. Warum bin ich überhaupt enttäuscht? Sie war süß, ja. Nur -- habe ich hier etwas gefühlt?
Ich horche. Ich höre nur ein fernes Piepen, und das gewisse Rauschen, von vielen, aber stillen Menschen in den umliegenden Zimmern.
Etwas gefühlt, ja. Aber nicht das.
Ich probiere, mir vorzustellen, wie ich sie vergewaltige. Wie sie mir den kleinen Finger reicht und ich ihre ganze Hand nehme, und noch mehr.
Und ja, da geht was. Säße ich hier noch nackt vor ihr, müsste ich spätestens jetzt ihren Spott aushalten. Oder zur Tat schreiten, und das, was sie sieht und sie belustigt, zu ihrer Realität machen.
Gerade als ich nicht mehr nur mit dem Gedanken spiele, mich anzufassen, bemerke ich ihr Affenköpfchen, das um den Türrahmen lugt. Ich fahre zusammen. Dieses Köpfchen steht mir vor Augen, wie es, auf meinem Schwanz steckend, um Rücksicht heult. Realität und Fantasie vermischen sich für Sekunden.
Wie lange steht sie da schon??
Mein guter Geist verliert keine Zeit. «Kommt bald Polizei» nuschelt sie, und verschwindet. Diesmal endgültig.
Verblüfft stand ich nackt im offenen Zimmer. Und was sollte das? Eine Warnung? Aber wieso warnte sie mich -- man hatte mir doch das Klemmbrett gegeben? Für meine Kontaktdaten; ich würde doch nicht --
Und wenn es ein Test war? Man ließ mich allein, um zu prüfen, ob ich nicht eine falsche Adresse eintrüge, und mich davonmachte? Ob ich Reue zeigte oder Fluchtverhalten? Man schickte mir eine süße Krankenschwester, die mich auszog, um festzustellen, ob --
Nein. Ihr vertraute ich. Beim Gedanken daran, daß ich Maria eben noch vergewaltigen wollte, zog sich mein Magen zusammen. Stumm, die Laute zurückhaltend und meinen Mageninhalt, taste ich im Dunkeln nach dem nächsten Waschbecken.
Ich erbrach mich.
Ich war krank. Ein krankes Schwein.
Aber ich hatte nicht geschossen. Ich hatte Marina nicht auf dem Gewissen. Das war doch dieser Jäger, dieser...
Vornübergebeugt stand ich am Waschbecken, hatte gekotzt und zitterte, als mir schwante, was das bedeutete.
‹Geh du› hatte er gesagt, und mir dabei jovial auf die Schultern geklopft.
Aber die Rettungsfahrer! Die hatten ihn doch gesehen! Die mussten sich erinnern!
Aber was hieß das schon?
Marina trug Schürfmale auf den Knien, würde es heißen. Sie trug Male von Seilen am ganzen Körper und alle meine Spuren -- DNA, Speichel...
Sie hatte sicher Freundinnen, die bestätigen konnten, daß sie sich heimlich mit mir traf; nachts in den Wald gegangen war. Sie würden sagen, daß es meine Initiative war, daß ich sie gedrängt hätte...
Ich hatte genug. Ich musste hier raus.
Ich konnte nicht auf die Bullen warten. Ich hoffte nicht darauf, daß sie mich verstanden.
Hastig kritzelte ich meine Telefonnummer -- und nur das -- auf das Klemmbrett, ließ es liegen, und stürzte -- mich ankleidend -- aus dem Zimmer.
***
- KOMMENTARE