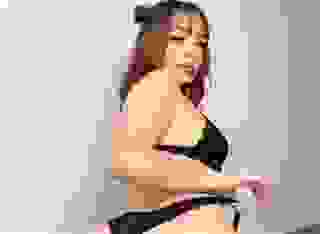Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hierUmso überraschter war er, dass Clarissa, kaum war Thomas volljährig geworden, ausgerechnet ihm Avancen machte und heftig mit ihm zu flirten begann. Clarissa hätte jeden haben können, doch aus irgendeinem Grund hatte sie an ihm einen Narren gefressen, einem noch nicht ganz der Pubertät entwachsenen, schlaksigen Hänfling mit Hühnerbrust und pickligem Gesicht und ohne jegliche nennenswerte sexuelle Erfahrung. Was mochte es wohl gewesen sein, was Clarissa an ihm gefunden hatte? War es einfach der Umstand, dass er noch so jung war, im Prinzip fast noch ein Kind, und Clarissa damit demonstrieren wollte, dass sie jeden haben konnte?
Dieses Rasseweib machte ihm nun jedenfalls den Hof und Thomas konnte kaum glauben, welch großes Glück er hatte. Wie oft war Clarissa ein elementarer Bestandteil seiner feuchten Träume gewesen? Wie oft hatte er sich vorgestellt, welche Dinge sie mit ihm wohl anstellen könnte und sich dabei selbstbefriedigt? Taumelnd vor Glück ließ er sich von Clarissa verführen und ehe er es sich versah, lag er nackt neben ihr im Bett und war bereit, mit ihr seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Doch dann hatte sich das Blatt gewendet. Kaum war Thomas mit seinem Glied eingedrungen, war es auch schon vorbei gewesen. Zu neu und zu überwältigend waren all die neuen Gefühle für ihn gewesen als dass er seinen Höhepunkt lange hätte hinauszögern können und so hatte er nach nur wenigen Stößen seinen klebrigen Samen in die mehr als 35 Jahre ältere Frau ergossen. Doch anstatt verständnisvoll und sensibel zu reagieren, hatte sie ihn ausgelacht. Sie hatte sich über sein mangelndes Durchhaltevermögen und sein winziges Gemächt lustig gemacht und ihn einen totalen Versager genannt. Clarissa war kein bisschen besser als seine Mutter und hatte ihm in Wahrheit nur deshalb schöne Augen gemacht, um ihn daran zu erinnern, was für ein erbärmlicher und unbedeutender Wicht er doch war. Doch das war längst nicht die größte Demütigung gewesen, die Thomas erdulden musste. Es kam noch viel schlimmer.
Noch am selben Abend hatte Clarissa sich mit seiner Mutter getroffen und bei einem Glas des allerteuersten Rotweins aus dem gut sortierten Weinkeller seines verstorbenen Vaters hatte Clarissa seiner Mutter brühwarm erzählt, wie sie deren Sohn am Nachmittag defloriert hatte und wie er grandios versagt hatte.
Noch heute hörte er, wie die beiden über ihn lästerten.
„Nach ein paar Sekunden war der Schlappschwanz schon fertig", hatte Clarissa gehöhnt.
„Etwas anderes hätte ich auch nicht erwartet", hatte seine Mutter geantwortet. „Genau wie sein Vater. Der war auch im Bett eine Niete."
„Den kleinen Stummelschwanz hat er dann wohl von ihm geerbt, was?"
„Na, denkst du etwa, dass er das von mir hat?"
„Stimmt. Aber jetzt mal ernsthaft, wie hast du es denn nur all die Jahre mit dem Vater deines Versager-Sohnes ausgehalten?"
„Man muss eben Opfer bringen, wenn man gut versorgt werden will. Und außerdem ... "
„Ja?"
„Wenn man daheim nichts Gescheites zu Essen bekommt, muss man sich eben außerhalb etwas gönnen."
„Du hast also mit anderen Männern gebumst?"
„Klar", hatte seine Mutter geantwortet. „Mein Mann mit seinem winzigen Pipimännchen hatte es doch sowieso nicht drauf. Am liebsten hab' ich es mir vom Tennislehrer besorgen lassen."
„Du bist unmöglich", hatte Clarissa geantwortet. „War es gut?"
„Und wie. Und weißt du was? Mein Mann hat es all die Jahre noch nicht mal gemerkt. Wie denn auch? Der Schlaffi hat ja nur gearbeitet."
Die beiden Frauen waren dermaßen in ihr Gespräch vertieft gewesen, dass sie gar nicht mitbekommen hatten, dass Thomas die zwei belauscht hatte. In diesem Augenblick war kalte Wut in ihm hoch gestiegen. Sein Vater hatte stets das Beste dafür gegeben, dass seine Frau in jedem nur erdenklichen Luxus leben konnte. Er hatte achtzig, neunzig Stunden pro Woche hart in seiner Firma gearbeitet. Hatte Weihnachtsfeste, Geburtstage und alle anderen wichtigen Feste versäumt und seine Mutter hatte es ihm gedankt, indem sie sich von anderen Kerlen hatte nageln lassen. Und nun hatte ausgerechnet diese abscheuliche Frau das gesamte Vermögen geerbt und gab es mit vollen Händen aus. Dazu war der verstorbene Schlappschwanz anscheinend gut genug gewesen. In diesem Augenblick empfand Thomas für seine Mutter und für ihre Freundin nichts als Abscheu und blanken Hass. Er wollte nicht mehr länger unter den Demütigungen und Schindereien dieser beiden Furien leiden müssen und begriff, dass er etwas tun musste. Er musste handeln, wenn er entkommen wollte. Genau in diesem Augenblick entschied Thomas, dass die beiden Frauen sterben mussten, wenn er endlich frei sein wollte.
Auf die erste Flasche Rotwein folgte bald schon eine zweite, dann eine dritte. Immer ausgelassener wurde der Abend und bald schon waren die beiden so betrunken, dass sie gar nicht mitbekamen, wie Thomas ihre Gläser heimlich mit Schlaftabletten versetzte. Benzodiazepine, die er in der Handtasche seiner Mutter gefunden hatte. Geeignet, um damit selbst einen ausgewachsenen Grizzlybären ins Koma zu versetzen. Dass der Wein plötzlich komisch schmeckte, bekamen die zwei Frauen gar nicht mit, so voll waren sie. Irgendwann schliefen die beiden Frauen, die Thomas in seinem Leben am meisten hasste, einfach auf der Couch ein. Und wurden nicht wieder wach. Die Medikamente, die zu den stärksten Schlafmitteln überhaupt zählten, lähmten ganz einfach ihre Atemzentren und der Alkohol verstärkte die grausame Nebenwirkung der Schlaftabletten noch zusätzlich. Die beiden hörten einfach auf zu atmen, das Gehirn wurde nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Einschlafen und nicht mehr aufwachen. Viele Selbstmörder hatten sich früher auf diese Weise ins Jenseits befördert. Heute war das nicht mehr ohne weiteres möglich, denn die Ärzte verschrieben Benzodiazepine heute aufgrund der heftigen Nebenwirkungen und des großen Missbrauchspotentials kaum noch. In Thomas' Augen war dieser Tod für seine Mutter und Clarissa aber noch viel zu einfach. Eigentlich hätten die beiden schlimmeres verdient gehabt.
Nachdem es vorbei war, fing für Thomas die Arbeit erst richtig an. Er setzte sich an den Schreibtisch und verfasste einen Abschiedsbrief, um den Tod der beiden Frauen wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. Er schrieb darin, dass die beiden eine langjährige lesbische Affäre geführt hätten und es nicht mehr aushielten, ihre Liebe nicht offen ausleben zu können. Die Gesellschaft würde dies einfach nicht verstehen und so sähen die beiden keinen anderen Ausweg als sich das Leben zu nehmen. Im Fälschen der Handschrift seiner Mutter war Thomas schon immer recht talentiert gewesen und nachdem er fertig war, sorgte er noch dafür, dass am Kugelschreiber und auf dem Briefpapier auch noch die Fingerabdrücke seiner Mutter zu finden sein würden, anschließend rief er den Notruf und erzählte am Telefon mit aufgelöster Stimme, dass er soeben nach Hause gekommen sei und seine Mutter und ihre beste Freundin reglos im Wohnzimmer gefunden habe und er sich nicht sicher sei, ob die beiden noch leben würden. Die Rettungskräfte, die daraufhin kurze Zeit später eintrudelten, konnten schließlich nur noch den Tod der beiden feststellen und drückten ihr tiefstes Mitgefühl aus.
Das Duschwasser wurde allmählich kalt und Thomas Renner kehrte mit seinen Gedanken wieder ins Jetzt zurück. Es war nicht so, dass ihn ein schlechtes Gewissen plagte. Keinen einzigen seiner Morde bedauerte er, ganz besonders nicht den an seiner Mutter und ihrer besten Busenfreundin. Im Gegenteil, für ihn war das der Befreiungsschlag gewesen. Er war nun ein freier Mensch und hatte nach der Tötung der beiden ihm so verhassten Frauen in seinem Leben erstmals seit dem Tod seines Vaters wieder einen Sinn gesehen. Er wusste nun, welches große Talent in ihm schlummerte. Niemand hatte je Verdacht geschöpft, dass der Tod der beiden Frauen kein Selbstmord war und Thomas Renner hatte schließlich begonnen, aus seinen Fähigkeiten ein Geschäft zu machen. Ein lohnendes Geschäft. Man glaubte gar nicht, wie viele Menschen für einen gut gemachten Auftragsmord beinahe schwindelerregende Summen bezahlten. Dabei war der Großteil seiner Kundschaft noch nicht einmal der übliche Abschaum. Weder die Mafia noch die Regierungen dieser Welt gaben die meisten Morde in Auftrag, sondern ganz gewöhnliche Leute. Renner hatte schon für eifersüchtige Ehefrauen, gierige Verwandte und für überarbeitete Männer gearbeitet, die ihren Boss unter der Erde sehen wollten. Irgendwann hatte er sein Geschäftsfeld erweitert. Heute machte er alle möglichen schmutzigen Geschäfte. Obwohl das Töten immer noch Renners Hauptgeschäftszweig war, bot er inzwischen auch anderweitige Dienste der illegitimen Sorte an und hatte sich sogar einen kleinen Mitarbeiterstab aufgebaut. Ein Team aus fünf Leuten arbeitete für ihn.
Sein aktueller Auftraggeber hatte sich für den Inhalt eines Bankschließfaches interessiert, der in diesem Augenblick in einem unscheinbaren Aktenkoffer verstaut war, der sich unter Renners Hotelbett befand. Kein besonders originelles Versteck, doch so war nun einmal das wirkliche Leben. Banal und unspektakulär. Sein Auftraggeber würde sich noch heute mit ihm treffen und ihm weitere Instruktionen erteilen. Mehr wusste Renner im Moment nicht und er stellte auch keine Fragen. Diskretion war die erste Regel, die es in seinem Berufsfeld einzuhalten gab. Es war auch eine der wenigen Regeln, die es überhaupt gab. Sah man vielleicht davon ab, dass eine weitere lautete, dass man von einem Geschäft nicht zurücktrat und es keine Stornierungen gab, existierten praktisch keine Regeln.
Renner stieg aus der Dusche. Er trocknete sich ab und lief dann immer noch nackt in das Schlafzimmer. Dort kleidete er sich mit einem neuen Maßanzug ein und sah auf die Uhr. Bis sein Auftraggeber sich melden würde, sollten noch einige Stunden vergehen, außerdem war bald Mittagszeit und Renner hatte schon längere Zeit nichts mehr gegessen. Töten machte immer so hungrig.
Kapitel 5: Großartiges in dieser Sicht auf das Leben
Julia knurrte der Magen. Seit dem Frühstück hatte sie noch nichts wieder gegessen und getrunken. Außerdem schätzte sie den Professor und seine liebenswerte Art als Gesellschaft beim Essen inzwischen sehr.
„Da ist aber jemand ziemlich hungrig", sagte Fisher mit verschmitztem Grinsen.
„Kann schon sein", sagte Julia verlegen, während die beiden einen weiteren Gang entlang schlenderten, der von den Kabinen des Wissenschaftspersonals zum gemeinschaftlichen Aufenthaltsraum führte. Kapitän Hansen hatte sich diskret entschuldigt, da man ihn auf der Brücke brauchte. Zum Abschied hatte er Julia die Hand geschüttelt und ihr noch viel Spaß an Bord gewünscht. Man würde sich sicher dann und wann einmal wieder über den Weg laufen, so groß sei das Schiff schließlich nicht. Julia war da ganz anderer Meinung. Das Schiff wirkte von innen fast schon wie eine kleine Stadt und die Vielzahl an Gängen und Korridoren war beinahe überwältigend. Sicher konnte man sich hier sehr gut verlaufen. Es würde bestimmt ziemlich lange dauern, bis sie sich einigermaßen zurechtfinden würde. Dennoch wusste sie schon jetzt, dass ihre Entscheidung, hier her zu kommen und diese Stelle anzunehmen, genau die richtige war.
„Unsere Küche ist nicht besonders groß, aber trotzdem lässt sich unser Smutje immer wieder etwas einfallen, um mit seinen kulinarischen Köstlichkeiten die Laune der Mannschaft hoch zu halten. Du musst unbedingt dabei sein, wenn er selbst gefangenen Fisch zubereitet. Frischer geht es gar nicht", erklärte Fisher.
„Klingt verlockend", antwortete Julia.
„Ich fürchte aber, dass du wohl heute mit meinen bescheidenen Kochkünsten Vorlieb nehmen musst. Der größte Teil der Crew hat noch Landurlaub und was soll schon ein Smutje auf einem Schiff, das noch tagelang im Hafen liegt?"
„Dann nehme ich an, dass es heute keinen Fisch gibt, oder?", klang Julia beinahe ein bisschen ernüchtert.
„Leider muss ich dich enttäuschen. Ich mag vieles können, kochen gehört nicht zu meinen Talenten."
„Was gibt's dann?"
„Das australische Nationalgericht, Dude. Das musst du unbedingt probiert haben -- sonst bist du nicht richtig in Australien gewesen."
„Okay, wenn das so ist, bleibt mir wohl keine andere Wahl."
Die beiden gingen rasch einige Schritte weiter und blieben schließlich vor einem Schott stehen, welches mit der Aufschrift common room versehen war.
Julia zögerte plötzlich. Nervös schaute sie den Professor an und sagte dann schüchtern: „Das wird jetzt aber keine australische Mutprobe á la bush food, oder so?"
„Ganz bestimmt nicht", lachte Fisher laut.
„Keine pürierten Kakerlaken, Känguru-Hoden oder solches Zeug?"
„Versprochen."
„Ehrenwort?"
„Von mir aus auch das. Wieso nimmst du aber an, dass wir so etwas essen würden?"
„Man sieht so einiges im deutschen Fernsehen."
„Viel Blödsinn, anscheinend", sagte Fisher und antwortete dann freundlich: „ich will, dass du noch eine Weile bei uns bleibst und nicht wegen des schlechten Essens bei der nächsten Gelegenheit über Bord gehst. Du kannst mir vertrauen, dass unsere Küche wirklich seriös ist."
„Dann ist es ja gut", murmelte Julia verlegen.
„Bist du dann bereit für die Küche des Grauens?"
„Bereit."
Fisher öffnete die Tür und die beiden betraten den Gemeinschaftsraum. Er war überraschend groß und gemütlich eingerichtet. Große Bullaugen ließen viel helles Tageslicht hinein und ihn einladend und fröhlich erscheinen. Der Fußboden war mit dunkel gebeizten Planken ausgekleidet, auf denen flauschige cremefarbene Teppiche ausgelegt waren. Linkerseits gab es eine gemütliche Sitzecke, die rund um einen großen Glastisch gruppiert war, direkt daneben stand ein schmales Bücherregal. Rechts befand sich eine kleine Kochnische mit Theke und ein paar Barhockern davor. Julias Blick schweifte über die Wände, die mit allerlei wissenschaftlichen Postern ausgekleidet waren. Direkt über der Sitzecke war die Wand mit einem Spruch aus kunstvoll verschnörkelten Lettern verziert worden: „There is grandeur in this view of life ... "
Julia erinnerte sich an die Worte. Es war ein Zitat aus einem der berühmtesten Bücher der Biologiegeschichte überhaupt. Niemand geringeres als der große Charles Darwin selbst hatte damit den letzten Satz seines wohl bedeutendsten Werks, On the Origin of Species, eingeleitet. Es war nur ein einziger Satz, aber er hatte, wie Julia fand, etwas wahrhaft Poetisches an sich. In ihrem fünften Semester hatte sie Darwins Buch gelesen und war von diesem letzten Paragraphen derart beeindruckt gewesen, dass sie ihn auswendig gelernt hatte. Passend dazu zierte die Wand direkt neben dem Zitat eine Kritzelei, die Julia ebenfalls nur allzu vertraut war. Es war eine Nachbildung von Darwins erstem Versuch, seine Evolutionstheorie in Form eines Stammbaums zu illustrieren, der alles Leben auf wundersame Weise miteinander verbindet und den er noch an Bord des Schiffs, mit welchem er einst die Welt erkundet hatte, der Beagle, in sein Notizbuch gezeichnet hatte. Überschrieben hatte er seine Skizze mit zwei simplen Worten: I think -- Ich denke. Unweigerlich fühlte Julia sich plötzlich selbst ein bisschen wie Darwin, dessen wissenschaftliche Karriere ebenfalls an Bord eines Schiffes begonnen hatte.
„Wow", sagte Julia, die aus dem Staunen kaum mehr heraus kam. „Das ist ja ... einfach Wahnsinn."
„Gefällt es dir?"
„Gefallen? Ich bin hin und weg", sagte Julia begeistert. „Wenn meine Studentenwohnung nur annähernd so ausgesehen hätte wie all das hier ... ich könnte glatt einziehen."
„Der Spruch, er stammt übrigens von ... "
„ ... Darwin, ich weiß. Hab' seine beiden Hauptwerke gelesen."
„Du hast diese alten Schinken wirklich gelesen?"
„Klar, warum nicht?"
„Ich bin beeindruckt. Meine Studenten zeigen nicht so viel Begeisterung für den guten, alten Darwin. Die meisten geben sich mit den Vorlesungsskripten völlig zufrieden."
„Da verpassen sie aber eine ganze Menge. Ich finde Darwins Bücher wunderbar. Sie stecken so voller Begeisterung. Die modernere Literatur ist ziemlich nüchtern, aber bei Darwin merkt man, wie toll er das alles selbst fand."
„Stimmt. Hast du übrigens gewusst, dass Darwin seekrank war?"
„Nein. Echt?", fragte Julia überrascht.
„Ja, ehrlich. Fast fünf Jahre dauerte seine Reise an Bord der Beagle. Die meiste Zeit davon hat er nur gekotzt. Eine beeindruckende Leistung, dass er trotzdem durchgehalten hat, wenn du mich fragst. Ich hatte schon Studenten, die gaben entnervt nach einem Tag wieder auf. Dabei ist das Schaukeln an Bord der modernen Schiffe kaum noch der Rede wert."
„Mein Magen ist zum Glück seetauglich", sagte Julia erleichtert.
„Na, da hast du aber ein Glück. So, und jetzt setz dich erst mal, während ich uns etwas zum Essen mache."
Julia nahm auf dem sehr gemütlichen Sofa Platz. „Darf ich dich was fragen, David?", fragte sie unvermittelt, während Fisher in der Kochnische eifrig damit beschäftigt war, nach etwas Essbarem zu suchen. Es war erstaunlich, wie vertraut sie miteinander schon umgingen, dabei kannten sie sich erst einen Tag lang persönlich. Aber so war das vermutlich, wenn man an Bord eines Schiffes war und sich nicht aus dem Weg gehen konnte.
„Klar."
„Etwas Persönliches?"
„Kommt drauf an wie persönlich."
„Na ja, ich habe mich nur gefragt, ob es eigentlich auch eine Frau Prof. Fisher gibt."
„Ach so", antwortete Fisher, der laut mit den Türen klapperte und sich gerade am Kühlschrank zu schaffen machte. Dann sagte er lachend: „Ich bin viel zu alt für dich."
„So meinte ich das nicht."
„Nicht? Gefalle ich dir etwa nicht?", sagte Fisher und tat gespielt beleidigt.
„Nein, also doch ... du siehst gut aus", sagte Julia und fügte dann schmunzelnd hinzu: „für dein Alter."
„Auf alten Schiffen lernt man bekanntlich das Segeln."
„Wenn du meinst."
„Ich meine nicht, ich weiß es."
An einem mangelte es David Fisher ganz offenbar nicht, nämlich Selbstvertrauen. Er grinste breit. „Das mit mir und den Frauen ist immer ... es ist ein wenig kompliziert", antwortete Fisher schließlich.
„Warum das?"
„Das übliche Problem. Wenn ich nicht gerade für mehrere Wochen unterwegs auf dem Forschungsschiff bin oder für's Fernsehen drehe, dann verbarrikadiere ich mich meist in meinem Büro in der Uni, halte Vorlesungen oder reise auf den Kongressen dieser Welt herum. Da bleibt kaum Zeit, um auch noch eine Beziehung oder gar eine Ehe pflegen zu können."
„Oh", antwortete Julia nachdenklich. So hatte sie noch gar nicht darüber nachgedacht. Sie hatte angenommen, dass Fisher sicher reihenweise Verehrerinnen haben musste, schließlich war er fast so etwas wie eine TV-Legende und sah wirklich ziemlich sexy aus. „So habe ich das noch gar nicht gesehen."
„Weißt du, ich habe es ein paar Mal versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe mir wirklich immer Mühe gegeben, aber letzten Endes bin ich wohl einfach mit meiner Arbeit verheiratet."
„Aber macht das nicht auf die Dauer einsam?"
„Doch, sehr sogar. Deshalb kann ich dir nur raten, es nicht so zu machen wie ich und das Privatleben nicht über das Berufsleben zu stellen."
Nachdenklich nickte Julia mit dem Kopf. Im Grunde genommen war sie im Begriff, genau das Gegenteil dessen zu tun, was Fisher ihr riet. Seit Jahren schon lenkte sie sich von den Geistern der Vergangenheit ab, indem sie sich geradezu wie eine Besessene in die Arbeit stürzte. Nun war sie sogar tausende von Kilometern von ihrem Zuhause weg gereist, um noch mehr zu arbeiten. Sicher, sie nannte es einen Neuanfang, einen Neustart. Neues wagen, um das alte Leben hinter sich zu lassen. Dabei war es in Wahrheit nichts anderes als eine Flucht vor der Vergangenheit.
„Und wie sieht es mit deinem Liebesleben aus?", fragte Fisher neugierig. „Hast du einen Freund?"
„Nein", antwortete Julia, „ich habe keinen Freund. Und auch keine Freundin."
„Oh", war es nun der Professor, der überrascht war.