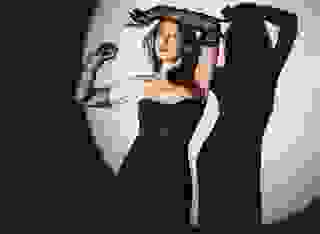Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hier„Dann sind Traditionen für die Wale wohl ziemlich wichtig, oder?", fragte der Chief.
„Das sind sie", antwortete Julia, „aber leider wird ihnen genau das immer wieder zum Verhängnis."
„Wieso das?"
Fisher fragte: „Weißt du, warum der Atlantische Nordkaper im Englischen Right whale genannt wird, der richtige Wal?"
Stewart schüttelte den Kopf. „Nein, warum?"
„Nordkaper haben eine extrem dicke Fettschicht, Blubber genannt. Vierzig Prozent ihres gesamten Körpergewichts entfällt auf das Fett. Sie schwimmen nur langsam, im Schnitt gerade einmal acht Kilometer pro Stunde, und halten sich bevorzugt in Küstennähe auf. Außerdem gehen die Kadaver der Nordkaper nicht unter wie bei den anderen Walarten, sondern sie treiben einfach an der Oberfläche. Das machte sie zum idealen Zielobjekt für die kommerzielle Waljagd, zum richtigen Wal für die Bejagung."
„Als man den Walen mit riesigen Fangflotten und Harpunen nachstellte, zeigten die Nordkaper praktisch keine Gegenwehr. Als hätten sie sich ihrem Schicksal gefügt. Die Walfänger mussten ihre Beute praktisch nur noch einsammeln. Das Abtrennen des Blubbers vom Körper, das Flensen, geschah oft schon, während das Tier noch im Wasser trieb und nicht etwa erst auf dem Schiffsdeck. Nachdem die Bestände fast an den Rand der Ausrottung gedrängt worden waren und sich die Jagd kaum noch lohnte, gerieten dann die anderen Großwalarten ins Visier der Waljäger", sagte Julia aufgewühlt.
„Bis zum Ende der kommerziellen Waljagd in den 1980er Jahren sind von einst geschätzt einhunderttausend Atlantischen Nordkapern gerade einmal etwa dreihundert Individuen übrig geblieben. Im Gegensatz zu anderen Walarten wie dem Buckelwal, die sich gut von der Waljagd erholen konnten und heute nicht mehr zu den bedrohten Arten gehören, ist die Zahl der Nordkaper kaum gestiegen und erholt sich nur langsam. Heute sind es vielleicht vierhundertfünfzig Tiere, möglicherweise auch fünfhundert. Manche Populationen sind zu winzigsten Resten zusammengeschrumpft. Die Population im Ostatlantik wird sich wohl nie wieder erholen und ist praktisch ausgestorben", sagte der Professor.
„Warum erholen sich die Bestände nicht, so wie bei den Buckelwalen?", fragte Stewart.
„Gute Frage", antwortete Fisher, „mit der fast gänzlichen Ausrottung der Nordkaperbestände ist vom ursprünglichen Genpool der Art nur noch ein Bruchteil vorhanden. Die Art ging durch einen genetischen Flaschenhals, der nur wenig der ursprünglichen genetischen Vielfalt übrig gelassen hat. Als Folge davon fanden und finden die Nordkaper viel zu wenig Fortpflanzungspartner, wobei Inzucht mit all ihren schädlichen Nebenwirkungen kaum noch vermieden werden kann. Hinzu kommt, dass die Tiere sich nur langsam fortpflanzen. Eine Kuh bekommt nur etwa alle drei Jahre ein einziges Kalb."
„Aber nicht nur genetisch wurde die Art stark eingeschnürt", schaltete sich nun Julia wieder ein, „der Walfang hat die Tiere im wahrsten Wortsinn auch ihrer Kultur beraubt. Mit jedem Tier, das die Walfänger aus dem Meer holten, ging für die übriggebliebenen Wale ein Stück ihres Wissens verloren. In der Bay of Fundy in Kanada zwischen den Provinzen Nova Scotia und New Brunswick gibt es eine kleine Kolonie Nordkaper, die seit Jahren unter einem immer schlechter werdenden Futterangebot zu leiden hat. In manchen Jahren gibt es kaum etwas zu Fressen. Viele Wale sind dann in einem schlechten Ernährungszustand und die sowieso nur wenigen Kälber verhungern."
„Aber warum schwimmen die Wale nicht weg? Dorthin, wo es Nahrung gibt?", fragte Stewart.
„Weil sie es verlernt haben", antwortete Julia traurig. „Die Wale wissen ganz einfach nicht mehr, dass sie in so einer Situation abwandern müssen. Und sie wissen auch nicht mehr, wohin sie in einem solchen Fall ziehen müssten; wo noch bessere Nahrungsgründe liegen und wie sie zu ihnen gelangen könnten. Diejenigen Wale, die es ihnen verraten könnten, hat der Mensch alle getötet."
Plötzlich herrschte gedämpfte Stimmung an Bord. „Dann gibt es für die Nordkaper keine Hoffnung mehr?", fragte Melina, die sichtlich mit ihren Tränen kämpfte.
„Seit einigen Jahren", sagte David Fisher, „beobachten Walforscher, dass einige der Tiere nordwärts ziehen. Sie folgen ihrer bevorzugten Beute, kleinen Ruderfußkrebsen der Art Calanus finmarchicus, immer häufiger in den weiter nördlich gelegenen Golf von St. Lorenz. Sie suchen neue Fanggründe. Sicher werden sie dieses Wissen mit den anderen Tieren ihrer Gruppe teilen. Vielleicht gibt es wirklich Hoffnung. Aber leider gibt es auch dort viele Gefahren für die Tiere. Denn die neuen Fanggründe liegen in international vielbefahrenen Gewässern und dort schwimmen auch viele Geisternetze im Meer. Alte Fischernetze, die zurückgelassen wurden und in denen die Wale sich verfangen und dann ertrinken. Zwischen April 2017 und Januar 2018 sind achtzehn Nordkaper in der Region ums Leben gekommen -- das sind rund vier Prozent der gesamten Population. Gleichzeitig geht auch die Geburtenrate zurück, von zwanzig Kälbern pro Jahr zwischen 2006 und 2016 auf gerade einmal fünf Kälber im Jahr 2017."
„Also doch keine Rettung?", fragte der Chief.
„Vielleicht doch", antwortete Fisher hoffnungsvoll. „Durch Begrenzung der Geschwindigkeit der Schiffe auf zehn Knoten konnte die Anzahl der Kollisionen in der Bay of Fundy um neunzig Prozent gesenkt werden. Wenn es gelingt, eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung auch im St.-Lorenz-Golf zu etablieren, dann könnte die Art vielleicht gerettet werden."
Kapitel 6: Übergabe
Das Wheel of Brisbane befindet sich direkt am Ufer des Brisbane River in den South Bank Parklands. Wie ein filigranes Gerippe ragt die stählerne Konstruktion des Riesenrades rund sechzig Meter in schwindelerregende Höhe. Mit seinen zweiundvierzig klimatisierten Kabinen für je sechs erwachsene Personen und zwei Kindern bietet es insgesamt einer Kapazität von dreihundertsechsunddreißig Besuchern einen herrlichen Rundumblick über die ganze Stadt. Rund zwölf Minuten benötigt eine Kabine für eine vollständige Umdrehung.
Die Kabine, in der der Mann saß, der sich Thomas Renner nannte, hatte soeben den obersten Punkt erreicht. Von hier oben wirkte die Stadt wie eine Modellbaulandschaft, wie ein Miniatur-Eisenbahnwunderland. Träge mäanderten die trüben Wassermassen des Brisbane Rivers an diesem sonnigen Tag durch die Stadt, um sich am Horizont direkt in die blaue See des endlos weiten Pazifiks zu ergießen. Renner hatte zuvor ein ausgiebiges Mittagessen in dem feinen Sternerestaurant seines Hotels genossen. Das ausgiebige Dreigänge-Menu hatte vorzüglich geschmeckt und war jeden einzelnen Cent der sündhaft hohen Rechnung wert gewesen. Doch Renner kümmerte sich nicht darum, was ihn der Spaß kosten würde, da ohnehin sein Auftraggeber sämtliche Auslagen übernehmen würde. Nach dem Mahl hatte Renner sich kurz auf sein Zimmer zurückgezogen und sich legerere Kleidung angelegt: helle Jeanshose, ein kurzärmeliges Freizeithemd und eine dunkle Schirmmütze, die er spottbillig in einem Souvenirshop gekauft hatte; selbstverständlich bar, damit niemand den Kauf zurückverfolgen konnte. Er hatte auf die freien Hautstellen dann noch eine dicke Schicht öliger Sonnencreme aufgetragen, sodass er in der Sonne nun glänzte wie eine Speckschwarte. Ein kleiner Rucksack ergänzte das auffällig unauffällige Outfit, mit dem er von den vielen gewöhnlichen Touristen nicht zu unterscheiden war. In den Rucksack hatte er die gestohlenen Unterlagen aus der Bank gepackt. Zuvor hatte er die dicke Mappe jedoch wasserdicht in einen stoßfesten Behälter gepackt, der genau in den Rucksack passte. Für den Fall der Fälle waren die Dokumente so gut geschützt. Anschließend hatte er sich auf den Weg gemacht und war nun dabei, so zu tun als wäre er ein ganz normaler Tourist, der einfach nur einen schönen Tag verbringen wollte.
Renner ließ seinen Blick über die Häuser der Stadt schweifen, die ihm in sechzig Metern Höhe wie einem König zu Füßen lagen. Der breite Fluss durchschnitt die Stadt wie ein blaues Band in zwei Hälften. Überall durchbrachen die grünen Tupfen der zahlreichen Parks und Grünanlagen das langweilige Grau der Beton- und Stahleinöde. Aus der Ferne hörte Renner das typische Konzert des Straßenverkehrs, eine Kakophonie aus dröhnenden Motoren, quietschenden Bremsen, markerschütternden Alarmsignalen und wütendem Hupen. Renner dachte an die Kleine, die er vor wenigen Stunden im Bett gehabt hatte. Der Sex mit ihr war zwar nicht außergewöhnlich gewesen, aber doch recht passabel. Er würde sich am Abend ganz sicher ein weiteres Mädchen gönnen. Vielleicht auch eine reifere Dame, solange sie noch ansprechend aussah und überzeugende Attribute vorzuweisen hatte. Bei dem Gedanken, sich am Abend noch etwas Spaß zu gönnen, spürte Renner schon vorfreudige Erregung in sich aufsteigen und merkte, wie sein Glied in seiner Hose zu zucken begann. Er fühlte, wie Blut in die Schwellkörper gepumpt wurde und sein Penis sich allmählich aufzurichten versuchte.
Noch nicht, ermahnte er sich selbst. Erst war noch ein Job zu erledigen.
Just in diesem Augenblick piepste sein Handy. Ein billiges Wegwerfmodell ohne moderne GPS-Unterstützung und kaum zurückzuverfolgen. Sein Auftraggeber hatte eine SMS geschickt. Renner warf einen Blick auf das leuchtende Display und lächelte. Der Treffpunkt war nicht weit von hier. Er prägte sich für den Fall der Fälle den exakten Wortlaut der Nachricht ein. Dann ließ er das Mobiltelefon in eine Plastiktüte gleiten, legte sie auf den Boden und trat kräftig darauf, sodass das Gerät in tausende Einzelteile geschrottet wurde. Selbst die besten Kriminaltechniker würden mit diesem Puzzle nicht mehr viel anfangen können. Falls sie die Teile jemals finden würden. Denn sobald seine Kabine wieder unten angekommen und er ausgestiegen wäre, würde er die Überreste des ehemaligen Handys ohnehin den Fluten des Brisbane Rivers überlassen. Von seinem Auftraggeber würde er in wenigen Minuten sowieso ein neues Telefon erhalten. Ausschließlich für den Zweck, ihm Ort und Zeit des nächsten Treffens mitzuteilen.
Nachdem die Kabine unten angekommen war und Renner wieder festen Boden unter seinen Füßen hatte, schlenderte er scheinbar ziellos zur Uferpromenade. Er tat so, als wolle er den Blick über den Fluss genießen und ließ dabei unauffällig den Beutel mit den Handyüberresten in die trägen Wassermassen fallen. Damit der Beutel auch wirklich sank, hatte er vorher noch einen schweren Stein hinein getan. Dann schlenderte Renner langsam zurück. Er ging ein paar Meter den Fluss entlang und fand sich schließlich am vereinbarten Treffpunkt ein, der Nepalesischen Pagode, die anlässlich der Weltausstellung 1988 errichtet worden war.
Auf einer Parkbank im Schatten saß ein älterer Herr und las Zeitung. Er war groß gewachsen, etwa Mitte bis Ende Sechzig und hatte volles, grau meliertes Haar und einen sorgfältig gepflegten, dichten Vollbart. An einer Leine führte er einen Hund. Irgendeine Promenadenmischung, von der Renner nicht eindeutig sagen konnte, welche verschiedenen Rassen sich hier miteinander vermischt hatten. Vielleicht ein Cockerspaniel und ein Labrador. Er hatte braunes Fell, große Schlappohren und niedliche Knopfaugen und winselte aufgeregt.
„Entschuldigen Sie?", fragte Renner.
„Ja?", entgegnete der ältere Herr und blickte von seiner Zeitung auf.
„Bitte, könnten Sie mir eventuell erklären, wie ich zur Adelaide Street komme?"
Der Mann lächelte. „Sie kommen nicht aus Brissie, stimmt's?"
„Nein."
„Tourist?"
„Ja", antwortete Renner, „und ich fürchte, ich habe mich komplett verlaufen."
Der Mann lachte laut auf als schien er sich über dieses Missgeschick köstlich zu amüsieren. „Wissen Sie", sagte er, „ich komme mit meinem Hund jeden Tag hier her. Beinahe täglich werde ich von einem Touristen nach dem Weg gefragt. Sie sind also in bester Gesellschaft."
„Normalerweise würde ich mein Handy befragen. Aber leider ist der Akku leer", log Renner.
„Da haben Sie aber Glück, Mister. Ich kenne mich hier bestens aus."
„Dann können Sie mir helfen?"
„Natürlich. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich habe eine Karte dabei."
Renner nahm neben dem Mann Platz. Der kramte aus einem kleinen Rucksack, die fast wie eine Männerhandtasche aussah, eine ziemlich zerfleddert aussehende Karte der Stadt hervor und faltete den Plan sorgfältig auf. Dann flüsterte der Mann leise in Renners Ohr: „Haben Sie es dabei?"
„Natürlich", entgegnete Renner.
„Stellen Sie den Rucksack ab", sagte der Mann. Er schob Renner ein Handy in die Hosentasche. „Warten Sie auf meine nächste Nachricht. Wir treffen uns, sobald ich die Dokumente eingehend geprüft habe und besprechen dann das weitere Vorgehen."
„Jawohl, Sir."
„Sehr gut."
„Wo haben Sie den Hund her?", fragte Renner.
Der Mann grinste: „Ausgeliehen."
Renner war immer wieder verblüfft, mit welcher Leichtigkeit sein Auftraggeber sich überzeugende Geschichten ausdachte. Der Hund hatte nur zur Tarnung gedient, das war Renner klar. Sein Auftraggeber hatte sich geschickt verkleidet, um den Eindruck zu erwecken, dass er nur ein alter Rentner war, der das sonnige Wetter bei einer Gassigehrunde mit seinem treuen Vierbeiner genießen wollte. In Wirklichkeit war der Hund irgendein fremdes Tier, das er wohl irgendwo aufgegabelt hatte.
Sein Auftraggeber fragte: „Ist Ihr Team bereit?"
„Ja, Sir. Alles ist vorbereitet. Die Ausrüstung ist unterwegs, hängt aber noch im Zoll fest. Meine Männer haben aber einen Zollbeamten bestochen. Wenn alles klappt, können wir morgen mit dem Beladen beginnen und dann wartet alles nur noch auf Ihr Kommando."
„Sehr gut", antwortete der ältere Mann lobend. „Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann."
Renner erhob sich. „Dann bis später", sagte er.
„Eine Sache wäre da noch, Renner."
Renner blickte seinen Auftraggeber fragend an. „Ja, Sir?"
„Nehmen Sie den Köter mit."
„Was soll ich mit ihm tun?"
„Mir egal. Werden Sie das Vieh einfach nur los."
Kapitel 7: Ein Wunderkabinett der Kuriositäten
Das Schnabeltier ist in jeder Hinsicht eine wirklich einzigartige Kreatur. Selbst hartgesottene Anhänger der Evolutionstheorie kommen beim Anblick dieses bizarren Geschöpfs ins Grübeln, ob nicht doch ein schöpferisch tätiger Designer bei der Erschaffung des Schnabeltiers beteiligt gewesen sein könnte. Das merkwürdige Tier sieht aus, als hätte Gott am letzten Tag der Schöpfung in die Restekiste gegriffen und es aus den verschiedensten Teilen zusammengesetzt, die gerade noch da gewesen waren. Es besitzt einen breiten entenartigen Schnabel, der von einer grauen und ledrigen Haut überzogen ist; kleine Knopfaugen wie bei einem Maulwurf; einen kurzen und gedrungenen Körper; samtig weiches braunes Fell wie bei einem Fischotter; kurze und, wie bei einer Eidechse, seitlich vom Körper abstehende Gliedmaßen mit riesigen Schwimmhäuten zwischen den Zehen und einen abgeplatteten Schwanz wie ein Biber. Als im Europa des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts erstmals Berichte über das Schnabeltier auftauchten, hielten die Gelehrten diese Meldungen für einen Scherz. Nachdem George Shaw, ein britischer Botaniker und Zoologe, im Jahr 1798 den Balg eines nicht ganz ausgewachsenen männlichen Schnabeltiers zugesandt bekommen hatte, schrieb er, es sei „unmöglich nicht einige Zweifel an der Echtheit dieses Tieres zu hegen und zu vermuten, dass hier einige Täuschungskünste an seiner Gestalt vorgenommen worden sein könnten." Er nahm an, dass womöglich ein chinesischer Tierpräparator aus verschiedenen Tierteilen eine Fälschung angefertigt haben könnte. Um seine Vermutung zu überprüfen, nahm er an der Basis des Schnabels einige Schnitte vor, die noch heute am Balg deutlich zu erkennen sind, um nach gut verborgenen Nähten zu suchen. Als er keine finden konnte, musste er einsehen, dass es sich nicht um ein geschicktes Täuschungsmanöver handelte, sondern die vor ihm liegende Kreatur zweifelsohne echt sein musste. Shaw fertigte einen detaillierten Bericht an, der schließlich 1799 veröffentlicht wurde. Damit wurde Shaw zum Erstbeschreiber dieser der Wissenschaft bis dato unbekannten Spezies. Seine Nachfolger und Kollegen beschäftigte das eigentümliche Wesen aber noch fast einhundert Jahre lang weiter.
Als Charles Darwin während seiner Reise an Bord der Beagle im Januar 1836 Australien erreichte, unternahm er eine mehrtägige Reise in die Blue Mountains in New South Wales. Dort beobachtete er erstmals lebende Schnabeltiere im Cox's River nahe Wallerawang und notierte in sein Reisetagebuch: „Kurz zuvor hatte ich an einem sonnigen Ufer gelegen & über den seltsamen Charakter der Tiere dieses Landes im Vergleich zum Rest der Welt reflektiert. Ein Ungläubiger in allem, was jenseits seiner eigenen Vernunft liegt, könnte ausrufen: ,Sicherlich müssen zwei verschiedene Schöpfer am Werk gewesen sein; ihr Ziel jedoch war dasselbe & sicherlich ist das Werk in jedem Fall am Ende erfüllt.'" Er war auf ein Phänomen gestoßen, das heute als konvergente Evolution bekannt ist -- Lebewesen, die sich unabhängig voneinander an den gleichen Lebensraum angepasst haben, entwickelten ganz ähnliche Merkmale und könnten auf den ersten Blick für nahe Verwandte gehalten werden, obwohl beide völlig unterschiedliche Vorfahren haben. Viele Historiker sind sich heute darin einig, dass jene Begegnung mit dem Schnabeltier eines der Schlüsselelemente für Darwin war, mit der seinerzeit gängigen Lehrmeinung über die Konstanz der Arten zu brechen und seine eigene, heute mit breiter Zustimmung anerkannte, Evolutionstheorie durch natürliche Selektion nachzudenken.
Das Schnabeltier avancierte schließlich zu einem wichtigen Beleg für Darwins Theorie. Denn das Schnabeltier ist ein lebendes Fossil. Obwohl es ein echter Säuger ist und typische Merkmale der Säugetiere aufweist, drei anstelle eines einzigen Gehörknochens, ein sekundäres Kiefergelenk, ein Fell und Milchdrüsen, zeigt es eine Reihe von reptilienartigen Merkmalen: sein Schultergürtel ist starr und besteht aus allen Knochen, die auch bei Eidechsen vorkommen, die Harn- und Geschlechtsgänge und der Darmtrakt münden in einen gemeinsamen Ausführungsgang, der Kloake, und -- es legt Eier. Letzteres wurde lange angezweifelt. Niemand geringeres als der große Richard Owen, der berühmte Gründer des Naturhistorischen Museums in London, zweifelte daran, dass Schnabeltiere Eier legten. Er gestand den Tieren allerhöchstens zu, dass es womöglich Eier in seinem Inneren trüge, die aber noch im Mutterleib schlüpften und dann lebend geboren würden. Erst 1884 konnte der endgültige Beweis dafür hervorgebracht werden, dass Schnabeltiere Eier legten, als man ein Weibchen erschoss, welches soeben ein Ei abgelegt hatte. Damit wurde das Schnabeltier endgültig zum Beweis dafür, dass die Säugetiere von reptilienartigen Tieren abstammen und dass sie, wie alle Lebensformen, nicht unveränderlich erschaffen worden waren, sondern sich in einem kleinschrittigen Prozess langsam aus einem gemeinsamen Vorfahren entwickelt hatten.
Das possierliche Tierchen, das flink durch das Wasserbecken glitt, angetrieben durch seine kräftigen Vorderbeine und den paddelartigen Schwanz als Höhenruder benutzend, schien sich um derartige Dinge nicht zu kümmern. Julia hatte natürlich schon Bilder von Schnabeltieren gesehen, trotzdem war auch sie beim Anblick dieses lebendigen Geschöpfs regelrecht verzaubert. Es sah einfach zu ulkig aus, wie der kleine Kerl unentwegt seine schnabelartige Schnauze hin und her bewegte und damit zwischen den Steinen des Untergrunds nach etwas Fressbarem, einem Krebschen, einer Schnecke oder einem Wurm, suchte. Wie Julia wusste, verfügt das Schnabeltier über einen ganz besonderen Sinn. Mit seinem Schnabel ist es in der Lage, die elektrischen Felder seiner Beutetiere zu orten und so die gut versteckten Leckerbissen aufzuspüren. Doch das sind längst nicht alle Kuriositäten, die das Platypus, wie die Australier das Tier nennen, zu bieten hat. Die männlichen Schnabeltiere besitzen an ihren Hinterbeinen einen Giftsporn, der wahrscheinlich bei Paarungskämpfen zum Einsatz kommt. Sie sind damit, neben den Plumploris Südostasiens, einigen Spitzmausarten und den seltsam anmutenden Schlitzrüsslern, die einzigen giftigen Säugetiere.