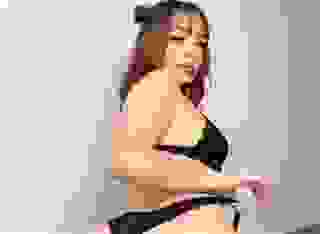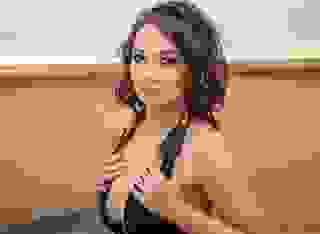- Sci-Fi & Phantasie
- Deborah und Die Bestie
Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hierTrashig-phantastische Erotikgeschichte im Manga-Stil
Für wenige Augenblicke hatte Deborah das schreckliche Gefühl, in einen bodenlosen, schwarzen Schacht zu stürzen.
Ihr tiefer Fall endete abrupt in einer feuchten, düsteren Höhle, in der nur einige blakende Pechfackeln an den kahlen, schroffen Felswänden ihr diffuses, flackerndes Licht spendeten. Trotz des großen Feuers, das in einem Kohlebecken vor sich hin gloste, war es bitter kalt, so daß die kleine, schlanke Debbie, die auf ihren zierlichen, nackten Füßen gelandet war und außer ihrem dünnen Nachthemd keinen Faden am Leib trug, erst einmal ganz erbärmlich fror.
Im nächsten Moment vernahmen Deborahs empfindliche Ohren helles, weibliches Lustgestöhn, und als sie sich nach der Ursache der animalischen Wonnelaute umsah, bemerkte sie sogleich zwei junge Mädchen, die sich im rauschhaften Taumel sexueller Ekstase auf einer dicken, roten Stoffdecke inmitten der Höhle wälzten und sich, obwohl sie splitterfasernackt waren, nicht im geringsten an der klammen Kälte zu stören schienen, die in dem unheimlichen Felsendom herrschte.
Allerdings sorgten die wollüstigen Aktivitäten der beiden außergewöhnlich hübschen Teenager wohl auch für genügend innere Wärme, überschütteten die Mädchen einander doch mit den heißesten und innigsten Küssen, während sie sich gegenseitig hemmungslos im Schritt streichelten.
"Komm zu uns, Deborah," säuselte die eine der beiden, ein schlankes, blutjunges Püppchen mit niedlichem, schwarzem Bubikopf und kleinen, festen Brüsten. "Spiel ein bißchen mit uns!"
"Ja, teile unsere Lust, Deborah," fiel nun das andere Mädchen, ein dralles, rothaariges und für sein zartes Alter schon recht vollbusiges Geschöpf, in den betörenden Sermon seiner Gefährtin ein. "Dein kleines Fötzchen schmeckt bestimmt so süß wie Honig!"
Obwohl die beiden schönen Teenies ihre Einladung mit ungemein sanfter und einschmeichelnder Stimme vortrugen, hatte Deborah dennoch die eigenartige Empfindung, es mit kalten, seelenlosen Automaten zu tun zu haben.
Unwillkürlich mußte sie an die alte Sage von den Sirenen denken, die Odysseus und seine Schar mit ihren lieblichen Gesängen auf ihre Insel locken wollten, um die ahnungslosen griechischen Seeleute, die der Magie ihrer Stimmen erlagen, aus dem Hinterhalt zu überfallen, ihnen ihre messerscharfen Krallen und Reißzähne ins Fleisch zu schlagen und sie genüßlich zu verspeisen.
Im übrigen war Deborah mit ihren gerade einmal achtzehn Jahren noch ein überaus kindliches und unerfahrenes Mädchen, so daß der Anblick purer, entfesselter Triebhaftigkeit, den ihr die beiden Teenager in der Höhle boten, auf sie alles andere als verlockend, sondern sogar ausgesprochen ekelhaft und abstoßend wirkte.
"Oh, ihr widerlichen, kleinen Nutten!" stieß Deborah daher auch entsetzt hervor, als die beiden jugendlichen Tribaden sich unvermittelt aufeinander legten, und zwar so, daß der Kopf der einen zwischen den zarten, weißen Schenkeln der anderen ruhte.
"Oh, ja, jaa, jaaaa!" schluchzte das zuoberst liegende, dunkelhaarige Mädchen mit vor Wonne erzitternder Stimme, als seine kupferrote Gespielin ihr süßes Köpfchen zu seiner rosigen Schamspalte empor reckte, ihre flinke, wissende Zunge über die weichen, im feuchten Glanz der Begierde schimmernden Hautfalten tanzen ließ und dabei zärtlich die niedlichen, wohlgeformten Hinterbacken streichelte, die prall und rund wie ein rosiger Vollmond über ihrem Gesicht schwebten.
Wenig später stimmte aber auch die dralle, kleine Fuchsstute eine jauchzende Jubelhymne an, flatterte die Zunge ihrer schwarzhaarigen Freundin doch nicht weniger sensibel und geschickt über ihren von spärlichem Kraushaar umkränzten Purpurschlitz.
"Komm, Deborah!" stöhnte der üppige Feuerkopf im dissonanten Tonfall rasenden Verlangens. "Gib uns deine süßen Titten, deine zarte Möse und deinen niedlichen, kleinen Arsch! Du wirst es bestimmt nicht bereuen!"
"Ihr ordinären, verdorbenen Schlampen!" brauste Deborah angesichts dieser mehr als eindeutigen Offerte empört auf. "Ihr ekelt mich an!"
"Aber warum denn, mein süßer Engel?" vernahm Deborah unvermittelt eine dunkle, sonore Männerstimme in ihrem Rücken, die ohne den triefenden Hohn, der darin mitschwang, beinahe angenehm geklungen hätte.
Sie wirbelte herum und - erstarrte!
Nein, so etwas Scheußliches wie dieses Monstrum, das da wie aus dem Nichts vor ihren weit aufgerissenen Augen auftauchte, durfte es einfach nicht geben! Zwar wirkte das Wesen auf den ersten Blick fast wie ein Mensch, aber eben nur auf den ersten Blick.
Mindestens zwei Meter groß, kahlköpfig und am ganzen Körper mit stahlharten Muskelsträngen bepackt, besaß das Ungetüm, das sich ihr ebenfalls in obszöner Nacktheit präsentierte, die breitesten Schultern und die stärksten, sehnigsten Arme, die Deborah je gesehen hatte.
Seine Haut glänzte in einem ausgesprochen häßlichen Giftgrün, und aus der Brust des Scheusals wuchsen zwei mächtige Tentakel, die jetzt mit geradezu unglaublicher Geschwindigkeit auf die von panischer Furcht gelähmte Deborah zu schnellten und ihren weichen, zierlichen Leib umfingen.
Willenlos, wie hypnotisiert, starrte Deborah in die stechenden, gelben Augen der Bestie, die das wehrlose Mädchen jetzt ganz langsam, aber unbarmherzig und mit einem zynischen Lächeln auf den harten, schmalen Lippen zu sich heran zog.
"Warum sollen meine bezaubernden Freundinnen sich nicht nach Herzenslust vergnügen?" höhnte das Untier, indem es jetzt zu allem Überfluß auch noch seine starken Arme zu Hilfe nahm und Deborahs Kopf roh zur Seite drehte, so daß der Blick ihrer angstgeweiteten Augen auf die beiden kleinen, geilen Flittchen fiel, deren leidenschaftlicher Orgasmus just in diesem Moment sein Ventil in einem gellenden Lustschrei fand, der sich in einem bizarren Echo an den kalten, grauen Wänden der Höhle brach.
"Im Gegensatz zu dir prüder Zicke haben meine süßen Hürchen wenigstens Spaß," fuhr das Monstrum mit seinem hämischen Monolog fort. "Viel mehr Spaß jedenfalls als dir dein einfältiger, primitiver Freund jemals bieten wird!"
Angesichts dieser verletzenden Provokation fand Deborah unvermittelt ihre Sprache wieder. "Laß John aus dem Spiel, du Ungeheuer!" schrie sie in ohnmächtiger Wut, während sie mit ihren kleinen Fäusten auf die schuppigen Tentakel der Bestie eintrommelte, deren eiserner Griff sich jedoch nicht im mindesten lockerte.
Vielmehr ließ das riesenhafte Biest jetzt ein schauriges, dröhnendes Gelächter vernehmen, und Deborahs Augen füllten sich mit Tränen der Furcht und der Verzweiflung, als ihr Blick auf den monströsen, blaugeäderten Penis des Ungetüms fiel, der wie ein pulsierendes Zepter viehischer Geilheit zwischen den stämmigen Schenkeln dieses Teufels aufragte.
"Ja, Deborah, sieh ihn dir nur an!" lachte die Bestie mit einem irren Funkeln in den gelben Augen. "Dieser Schwanz ist das Symbol meiner Macht über dich! Und schon bald wird er dich zu meiner Königin erwählen!"
Dies war der Moment, in dem Deborah schweißgebadet und mit einem schrillen Entsetzensschrei erwachte und sich in ihrem völlig zerwühlten Bett wiederfand...
---
"Aber Deborah, du ißt ja gar nichts!" stellte Jennifer Mc Kenzie bestürzt fest, während sie ihrer Tochter zusah, die auch an diesem Freitagmorgen nur müde und lustlos an ihrem Frühstücks-Sandwich herumsäbelte und dazu hin und wieder mechanisch an ihrer Tasse Kaffee nippte.
Zur Besorgnis hatte die attraktive, blonde Jennifer, der man ihre vierundvierzig Jahre keineswegs ansah, allerdings auch allen Grund, denn schon seit Wochen litt Deborah an schrecklichen Alpträumen, die sie kaum eine Nacht ruhig schlafen ließen. Zwar hatte Debbie ihrer Mutter noch keine konkreten Inhalte offenbart, doch mußte das, was das arme Kind Nacht für Nacht durchmachte, der absolute Horror sein.
Auf jeden Fall wurde die ohnehin schon ausgesprochen schlanke, fast magere Deborah infolge ihrer allnächtlichen Tortur langsam aber sicher immer zierlicher und zerbrechlicher, und ihre großen, blauen Augen, die der zarten Gestalt des hübschen Mädchens eine fast elfenhafte Note verliehen, nahmen einen zunehmend melancholischen und in sich gekehrten Ausdruck an.
"Ach, Mom, ich habe einfach keinen Appetit," stöhnte das Mädchen gequält. "Ich habe gestern wieder die halbe Nacht wach gelegen und fühle mich ehrlich gesagt wie gerädert!"
Angesichts der Resignation und Hoffnungslosigkeit, die aus den Worten ihrer Tochter sprachen, mußte Jennifer Mc Kenzie jedes Quentchen Willenskraft mobilisieren, um ihre Tränen zurückzuhalten, doch wußte sie, daß eine verzweifelte Heulsuse ungefähr das letzte gewesen wäre, was Deborah jetzt brauchte.
Also versuchte Jennifer, stark zu sein. Ganz langsam erhob sie sich von ihrem Stuhl, umrundete den Küchentisch, beugte sich über ihre Tochter und strich ihr sehr sanft über das seidige, braune Haar.
Deborah stand jetzt ebenfalls auf und schmiegte sich schluchzend in die warmen, weichen Arme ihrer Mutter, die ihrem Mädchen zärtlich den schmalen, zierlichen Rücken streichelte und dabei beruhigend auf sie einredete: "Ist ja gut, kleine Debbie, ist ja schon gut!"
Jennifers körperliche Nähe schien Deborah in der Tat ein bißchen zu trösten, blickte das Mädchen doch unvermittelt und mit tränenumflorten Augen zu ihr empor, lächelte sanft und sagte: "Danke, Mom, das hat mir wirklich gut getan. Mein Gott, was wäre ich ohne dich!"
"Ach Kind," seufzte Jennifer schwer und wandte sich ab, damit Deborah die Tränen nicht sah, die sie jetzt trotz aller guten Vorsätze doch nicht mehr länger zurückzuhalten vermochte.
Deborah indes bemühte sich nach Kräften, wenn auch vergeblich, ihrer Stimme einen fröhlichen und zuversichtlichen Klang zu verleihen, als sie ihre Schulmappe schnappte und mit einem kurzen "Bye, Mom, ich muß los!" das Haus verließ, vor dessen Eingang Debbies Freund John Calahan bereits ungeduldig auf seine Liebste wartete.
John, die treue Seele, gehörte zu den wenigen Menschen, die trotz Deborahs schlimmer körperlicher und seelischer Verfassung fest zu ihr hielten und das arme Mädchen nach Kräften zu trösten und aufzumuntern versuchten.
Jennifer indes zermarterte sich wieder und wieder das Hirn, indem sie nach den Ursachen der Alpträume ihrer Tochter forschte und alle möglichen Bücher und Internet-Blogs zu diesem Thema verschlang, in denen sie allerdings auch keine befriedigenden Antworten fand.
Konnte es vielleicht daran liegen, daß Deborah mit der Scheidung ihrer Eltern nicht fertig wurde?
Zwar war ihr Vater Bill, der erfolgreiche Börsenmakler mit eigener, phantastisch florierender Brokerfirma, ein hoffnungsloser Workaholic, der sich nur ausnahmsweise einmal um seine Familie kümmerte, doch hatte Debbie diesen Mann, von dem sie ihren dichten, braunen Haarschopf und eine gehörige Portion Ehrgeiz geerbt hatte, abgöttisch geliebt und war, nachdem sich Jennifer vor einem Jahr endgültig von ihm getrennt hatte, über Monate in tiefer Melancholie versunken.
Erst ganz allmählich gewöhnte sich das Mädchen an den Gedanken, fortan bei seiner Mutter zu leben und seinen Dad nur dann zu Gesicht zu bekommen, wenn dieser sich alle Jubeljahre einmal von seinem Job loseisen konnte, was in letzter Zeit allerdings auch immer seltener vorkam. Nun, wenigstens überwies dieser egozentrische, von seiner Arbeit und vom Geld geradezu besessene Schuft pünktlich seinen Unterhalt und ermöglichte Jennifer und Deborah dadurch eine sichere und sorgenfreie Existenz. Doch konnte selbst die beste materielle Versorgung kein glückliches Familienleben ersetzen, und Jennifer wußte nur zu gut, daß ihre Tochter darunter noch immer schwer litt.
Andererseits jedoch gehörten wochenlang anhaltende, schreckliche Alpträume nicht unbedingt zu den typischen Symptomen eines Scheidungstraumas, und so schickte die ratlose Jennifer ihre Tochter von einem Psychotherapeuten zum nächsten. In ganz Denver gab es wohl kaum eine psychiatrische Praxis, deren Sprechzimmer die blutjunge Deborah Mc Kenzie noch nicht von innen gesehen hatte.
Die Ärzte führten lange, ausführliche Analysegespräche mit Deborah und verschrieben ihr Antidepressiva und schlaffördernde Medikamente, die ihre überbordende Traumtätigkeit dämpfen sollten, doch leider brachte nichts von alledem den so heiß ersehnten Erfolg. Jennifer machte den Ärzten ihre Hilflosigkeit nicht zum Vorwurf, sah sie doch ein, daß die Mediziner sich nach Kräften um Debbie bemühten, doch war diese Erkenntnis für Mutter und Tochter letztendlich nur ein schwacher Trost.
Die Alpträume blieben, wurden sogar immer furchterregender, und Deborahs physischer und psychischer Zustand verschlimmerte sich zusehends.
Für Jennifer war es ein wahres Wunder, daß die schulischen Leistungen ihrer Tochter darunter in keiner Weise litten, doch drängte sich ihr mehr und mehr der Verdacht auf, daß Deborah ihre zunehmende Verzweiflung in Arbeit zu ersticken trachtete und der endgültige körperliche und geistige Zusammenbruch des Mädchens nur noch eine Frage von Tagen war.
Und kaum hatte Deborah das Haus verlassen, setzte sich Jennifer wieder an den Küchentisch, stützte den Kopf in beide Hände und ließ endlich jenen Tränen freien Lauf, die ihr allerdings auch nur für kurze Zeit Erleichterung verschaffen konnten...
---
Zur gleichen Zeit, irgendwo in den Tiefen der Milchstraße:
Das unbegreifliche, sphärische Gebilde aus strahlender Formenergie zog seine stille Bahn um eine der in diesem Sektor der Galaxis zahlreichen blauen Riesensonnen, doch kaum war das Funksignal aus den Weiten des Universums eingegangen und vom Bordcomputer mit annähernder Lichtgeschwindigkeit ausgewertet worden, erwachten die komplizierten Apparaturen im Innern der Station zu neuem Leben und entwickelten eine geradezu hektische Aktivität.
Zunächst wurden sämtliche Räumlichkeiten des Sphäroids mit frischer, sauerstoffreicher Atemluft geflutet. Augenblicke später flammte in einem kleinen Raum im Zentrum des Stützpunktes die Beleuchtung auf. Dann pumpte das vollautomatische Lebenserhaltungssystem die glasklare Nährflüssigkeit aus dem Schlaftank, in dem der hochgewachsene Humanoide, der sich zur Zeit allein auf der Station aufhielt, seine Regenerationsperiode verbrachte.
Xanthor gehörte zum Volk der Keldorin, dessen Heimatgalaxis viele Millionen Lichtjahre von jenem Sternensystem entfernt war, in dem er seinen einsamen Dienst versah. Zwar benötigte ein Keldo-Wächter keine regelmäßige Nachtruhe, doch gehörte es seit undenklichen Zeiten zu den Vorschriften der Organisation, daß sich jeder ihrer Angehörigen, egal, welchem der zahllosen Mitgliedsvölker er angehörte, alle fünfzig Keldor-Jahre für sechs Standardmonate in den Tiefschlaf zu begeben hatte, denn der Kampf gegen das Böse war nun einmal hart und kräftezehrend - selbst für Wesen mit den unermeßlichen physischen und psychischen Ressourcen eines Wächters.
Xanthor schlief noch immer, als sich die transparente Abdeckplatte seines Regenerationstanks lautlos öffnete, die langen, metallenen Greifarme der stationseigenen Servomatik seinen Körper sanft massierten und auf diese Weise dafür sorgten, daß die Blutzirkulation wieder in Gang kam und die vom monatelangen Kälteschlaf steife Muskulatur des Keldo ihre alte Geschmeidigkeit zurückerlangte. Stimulierende Injektionen aus dem Medokit des Servos taten ein übriges, und schon nach wenigen Minuten war Xanthor zumindest physisch wieder der Alte.
Folglich galt es jetzt, auch seinem Geist zu neuer Vitalität zu verhelfen.
Von leise summenden Antigravfeldern getragen, schwebte die metallene Elektrodenhaube des Neuronalstimulators auf den Kopf des blonden Hünen herab, dessen Haut in einem fahlen, fast albinotischen Weiß schimmerte, das jedoch die normale Körperfarbe eines jeden Keldo war.
Xanthor brummte unwillig, als die schmerzhaften Weckimpulse der Haube wie glühende Nadeln in sein Gehirn stachen, doch bot diese brutale Prozedur den immensen Vorteil, daß der Schläfer binnen weniger Sekunden wieder hellwach und putzmunter wurde.
Der Unmut des hochgewachsenen Humanoiden steigerte sich noch, als sein Blick auf den Chronometer des Schlafraums fiel, dessen leuchtendes Display einen Zeitwert anzeigte, der dem Keldo ganz und gar nicht behagte, war Xanthor doch fast einen Standardmonat vor dem regulären Ende seiner Schlafperiode geweckt worden.
"Computer, was ist los?" rief er daher ziemlich erbost, nachdem er seinen Schlafbehälter verlassen hatte. "Hat dir jemand auf den Prozessor gepißt? Warum holst du mich vor der Zeit aus dem Tank?"
"Die erste Frage möchte ich überhört haben, Wächter Xanthor," meldete sich nun die wohlmodulierte weibliche Stimme der Bordpositronik zu Wort, eines hochentwickelten Supercomputers, der es tatsächlich fertigbrachte, seinen Worten so etwas wie einen indignierten Tonfall zu verleihen.
"Was Frage Nummer zwei angeht, so liegt mir ein Alarmruf der Zentrale Ogriv mit oberster Prioritätsstufe vor, der leider keinen Aufschub duldet. Näheres erfahren Sie im Briefing-Room, und jetzt darf ich Sie bitten, sich auf Ihr Gespräch mit Clusterkommandant Xipoc vorzubereiten!"
"Ach, leck mich doch!" knurrte Xanthor, als wenige Sekunden später ein Servomodul in den Schlafraum schwebte und dem Wächter seinen weißen Kampfanzug und sein Multifunktionsschwert überreichte. Kurze Zeit später jedoch steckte der nur noch scheinbar unwirsche Keldo bereits in dem leichten, eng anliegenden Overall, dessen Material man seine quasi unzerstörbare Konsistenz keineswegs ansah, schnallte sich den breiten Gurt mit der hochmodernen Energiewaffe um, bei der es sich in Wahrheit ebenfalls um weit mehr als das Schwert handelte, das sie auf den ersten Blick zu sein schien, und begab sich mit dem Antigravlift in den Instruktionsraum seines Stützpunkts.
Kaum hatte Xanthor den Briefing-Room betreten, flammte eine Batterie Leuchtstoffröhren auf und erfüllte den Raum mit warmem, angenehmem Licht.
Xanthor wuchtete seinen massigen, durchtrainierten Körper in einen der bequemen Konturensessel, und im gleichen Augenblick aktivierte der Stationsrechner auch schon den großen Panoramaschirm, der in die gegenüberliegende Wand des Raumes eingelassen worden war.
Xanthor hob respektvoll die Hand zum Gruß, als das überlebensgroße, holographische Konterfei Commander Xipocs auf der Mattscheibe erschien. Der Befehlshaber sämtlicher Wächter in diesem Galaxienhaufen war ebenfalls ein Keldo, wenn auch ein wesentlich älteres und erfahreneres Exemplar seiner Spezies als der hünenhafte Xanthor.
Vermutlich lag es an den überragenden parapsychischen Fähigkeiten der Keldorin, daß ihr Volk innerhalb des Ordens eine dominierende Rolle spielte. Auf Xanthors ferner Heimatwelt sollte es sogar religiöse Sektierer geben, die in den Keldorin Lieblinge der Götter sahen. Erklärten Skeptikern wie Xanthor und Xipoc war derlei Gedankengut selbstverständlich völlig fremd. Wenn es für sie auch nach wie vor ein Rätsel darstellte, wer die eigentlichen Auftraggeber des Wächterordens waren, so glaubten die beiden dennoch weder an eines oder mehrere göttliche Wesen, und einen Dünkel gegen andere Völker hegten sie schon gar nicht, kannten sie doch die lange, leidvolle Geschichte ihrer Spezies, in deren fernster Vergangenheit sich die verschiedenen Stämme der Keldorin blutige Kriege geliefert hatten, weil jede der Keldo-Nationen glaubte, allen anderen überlegen zu sein und sich ihnen gegenüber Exklusivrechte anmaßen zu dürfen.
Xanthor verscheuchte seine irrelevanten Gedanken mit einem unwilligen Knurren und konzentrierte sich jetzt voll und ganz auf die Botschaft, die Kommandant Xipoc ihm übermittelte.
"Ich grüße Sie, Wächter Xanthor!" eröffnete der ältere der beiden Keldorin das Gespräch.
"Ich darf mich zunächst in aller Form bei Ihnen entschuldigen, daß wir Sie vor der Zeit aus der Regenerationsphase geholt haben, doch ungewöhnliche Umstände erfordern nun einmal ungewöhnliche Maßnahmen. Außerdem befindet sich Ihre Station gewissermaßen im Epizentrum der bedrohlichen Entwicklung, die den Orden zu unverzüglichem Handeln zwingt.