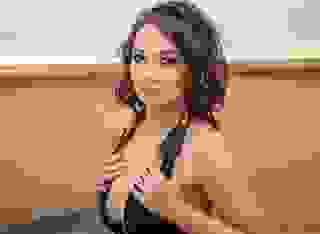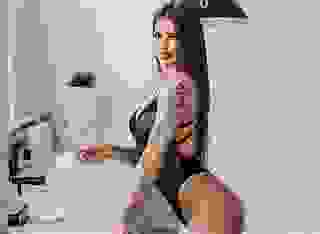Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hierEin unglaubliches Verlangen danach, ihren jungfräulichen Arsch erst mit den Handflächen und dann mit einem Flogger zu bearbeiten, bis er glühte, kam in mir auf. Sie stöhnte auf, weil ich bei diesen Fantasien unbewusst einen Gang hochgeschaltet hatte und meine Glocken immer schneller gegen ihre Klit schlugen. Während mir der Schweiß ausbrach, legte ich meine rechte Daumenkuppe auf ihre Rosette und begann, diese zu massieren.
„He, Jonas, bitte nicht da! Ich mag das nicht so", kam es vom anderen Ende her.
Missmutig stieß ich noch ein paar Mal hart zu, riss meinen Schwanz kurz vor dem Höhepunkt heraus und spritze lustbefreit auf ihren Arsch ab.
„Och nee", maulte sie enttäuscht, während ich fasziniert zusah, wie mein frisches, weißes Sperma in ihre Analfalte und schließlich über den Ringmuskel rann.
Sie fuhr vom Bett hoch und rannte ins Bad, um sich zu abzuwaschen. In diesem Moment wusste ich bereits, dass auch diese Beziehung nur eine Kurzgeschichte in meinem Liebesleben war. Oder eher ein schmaler Absatz. Snoopy und ich hatten zu tief in den Goldminen sexueller Befriedigung geschürft. Die Droge Daniela war zu schwach dosiert und hatte eine zu kurze Halbwertszeit, um eine messbare Reaktion bei mir auszulösen.
Nach dem kurzen Gastspiel mit ihr hatte ich für einige Wochen alle Mühe, sie mir bei der Arbeit vom Leib zu halten. Wahrscheinlich lag es daran, dass meine lahmen Ausreden für den harten Cut zu unglaubwürdig rüberkamen. Aber wie hätte ich dieser zarten Blume erklären sollen, dass ich in meiner letzten Beziehung zum Junkie geworden war. Dass ich nachts zuletzt davon geträumt hatte, sie geknebelt an den Heizkörper zu ketten, und ihr meine linke Faust mit viel Crisco langsam und tief in den in den jungfräulichen Arsch zu schieben, während meine rechte sie mit dem Flogger zum Höhepunkt peitschte. Sie hätte das niemals verstanden, weil für ihr mitfühlendes Wesen Lust und Schmerz zwei Welten waren, die auf ihren Umlaufbahnen einander nie begegneten.
Im Umkehrschluss musste ich mir eingestehen, dass ich mich auf eine zärtliche Beziehung im Moment gar nicht mehr einlassen konnte und fühlte nur noch eine unendliche Leere in mir, weil ich mich insgeheim genau danach sehnte.
*
STEFANIE
Monate nach dem Techtelmechtel mit Daniela traf ich auf der Medizinerparty Stefanie. Grinsend stellte sie sich mir nach kurzem, seichtem Smalltalk als Steuerfachgehilfin vor. Fest davon ausgehend, dass sie flunkerte, gab ich vor, Gutachter bei der Fleischerei-Innung zu sein. Stefanie, die sich an diesem Abend einfach an ein paar befreundete Kommilitonen der medizinischen Fakultät gehängt hatte, war allerdings tatsächlich Steuerfachgehilfin und bot mir in derselben Nacht ihr eigenes Fleisch auf durchaus verschiedene Weise zur Begutachtung an. Unsere Beziehung begann mit einem harten Spontanfick im Flur ihrer Wohnung, kaum dass wir diese betreten hatten. Ein demoliertes Schuhregal war als Kollateralschaden zu verschmerzen. Erst im Nachgang begannen wir zur Abkühlung zärtlich auf ihrem King-Size-Bett rumzuknutschen. Nachdem ich um drei Uhr morgens nach einem ausgiebigen Schädelfick tief in ihre Kehle abgespritzt hatte, outete ich mich als angehender Internist und erklärte, dass das Sperma im Säurebad ihres Magens bei ph1,4 keine Überlebenschance hätte und überdies die einzige Körperflüssigkeit beim Menschen sei, die Fruktose enthielt. Sie lachte und versicherte mir, dass sie dann doppelt froh darüber wäre, nicht an einer Fruktoseintoleranz zu leiden. Als wir am Mittag entspannt frühstückten, hatte sie sich beim letzten Höhepunkt sogar schon einen Finger bis zu den Knöcheln in den Arsch schieben lassen. Es sah alles nach einer Pole Position für eine kurzweilige Liaison aus!
Mit Stefanie verband mich Wochen danach eine Amour Fou. Sie war zeitweise unersättlich und forderte mich heraus. Nahm von mir, was sie brauchte. Wenn ich zerschlagen von der Uniklinik zu ihr nach Hause kam spürte ich oft nach wenigen Minuten ihre Hand an meinem Latz. Spürte, wie sich ihr sinnlicher Mund um meine Eichel schloss, um mir meinen Samen ein paar Stellungen später in reverse-cowboy-Position zu rauben.
Ich hatte damals allerdings keinen Grund zur Klage. Stefanie war weltgewandt und organisierte für uns in wenigen Minuten Städtetouren mit Museums- und Opernbesuchen an den Wochenenden. Zielsicher fand sie auf ihrem Tablet die Hotels, in denen wir unserem wilden Treiben ungestört nachgehen konnten. Dass sie mich mit ihrem Job teilweise finanziell aushielt, bereitete mir kein Kopfzerbrechen. Ich würde mich später bei ihr revanchieren!
Während mein Schwanz immer schneller in ihrem Mastdarm auf und ab stampfte, griff ich rasch unter das Kissen, wo ich kurz vor unserem Fick eine Überraschung deponiert hatte. Der Sex-Shop war heller und cleaner gewesen als damals in Berlin, die Auswahl langweiliger und von der Stange. Aber sie sollte genügen! Stefanie fuhr herum und riss die Augen auf, als der erste Schlag mit dem Flogger zwischen ihren Schulterblättern niedersauste, während ich meinen Penis bis zum Anschlag in ihren Arsch rammte. Ich wischte ihr mit den weichen Riemen noch ein paar Mal quer über den Rücken und den Po, bis ich einen gewissen Unmut in ihrem schweißüberströmten Gesicht wahrnahm.
„Hör auf mit dem Quatsch und fick mich härter! Mach schon!", ächzte sie und der Flogger mit der blauen Wildledertroddel landete nach einem kurzen Gastspiel arbeitslos auf dem Bett neben uns. Als ich breitbeinig über ihr stehend tief in ihre Gedärme abspritzte, rollte das Schlagwerkzeug vom Bett und landete hinter einer Topfpflanze. Ich sah auf einmal einen schneeweißen, schmalen Rücken vor mir und spürte, wie die Erektion im Enddarm meiner Partnerin schneller nachließ als sonst.
In den Tagen nach diesem Ereignis musste ich oft darüber nachdenken, dass Stefanie nicht gut damit klarkam, wenn ich sie dominieren wollte. Sie war ein Dickkopf und hatte auch bei ihrem Job ihre Zahlen fest im Griff. Diesen festen Griff bekam ich bald darauf am eigenen Leib zu spüren. Nach unserem nächsten Vorspiel ließ sie mich die Augen verbinden und bat mich freundlich, mit emporgestrecktem Po auf dem Bett zu liegen. Ich hatte wohl mit einem sanften Handjob von hinten gerechnet. Stattdessen ließ sie mich die Hände auf den Rücken nehmen und beim Klicken der Handschellen wurde mir klar, dass es heute anders laufen würde. Ich spürte, wie sie mir einen Kunststoffkäfig um Hoden und Schwanz legte und eng verschloss. Damit nicht genug, stopfte sie mir einen Ball Gag zwischen die Zähne und zog ihn fest. Es dauerte nicht lange, bis ihre Hände auf meine Pobacken niedersausten und ich eine pulsierende Wärme vom Kreuz bis zu den Oberschenkeln spürte.
„Heute bist du fällig, Jonas", lachte sie und kruschtelte neben dem Bett herum.
Der erste Schlag mit dem Flogger, den ich eigentlich für sie gekauft hatte, war eben noch erträglich. Dann prasselten die Hiebe nur so auf mich nieder, bis ich ein Wimmern nicht mehr unterdrücken konnte. Die Handschellen schnitten durch die vergeblichen Ausweichbewegungen bald tief in meine Handgelenke. Ich hätte natürlich vom Bett aufspringen können, wollte aber kein Spielverderber sein. Nach einer Verschnaufpause, in der sie wieder irgendetwas holte, dachte ich, würden wir zum gewohnten Programm zurückkehren. Doch weit gefehlt!
Nachdem sie ihren Zeigefinger mit viel Gleitmittel in meinen Arsch gebohrt hatte, begann sie kräftig meine Prostata zu massieren. Aber nicht so sanft, wie Snoopy es immer getan hatte, sondern derb und ohne jegliches Feingefühl. Ich hatte bei ihr sofort den Drang, pissen zu müssen und konnte auf einmal gut nachvollziehen, wie sich manche Männer fühlten, bei denen ich eine Krebsvorsorge machte. Nach dem Aufbau eines zunächst angenehmen, dann jedoch eher schmerzhaften Drucks, entleerte sich mein Sperma fast ohne Pulsieren in den Peniskäfig und tropfte träge aufs Bett.
„So, Jonas. Wie wäre es, wenn wir das ab jetzt jede Woche einmal durchziehen. Vielleicht werde ich ein Strichliste anlegen. Oder gleich ein Profil in unserer Steuerberatungssoftware!", kicherte sie.
Mit dem Ballgag im Mund hatte ich außer einem Mhhh Mhhh nichts erwidern können. Der Gedanke, dass sie die Schläge in irgendwelche Tabellen eintrug, kam mir surreal vor... Paddel 10x, Reitgerte 12x, Riemenpeitsche 15x, Ruinierter Orgasmus 1x... Allerdings beschlich mich das ungute Gefühl, dass Stefanie es mit ihrer Pedanterie durchaus ernstgemeint haben könnte!
In der Lernphase vor dem zweiten Staatsexamen registrierte ich, dass ich schon viel zu tief drinhing. Stefanie wollte mich nicht nur im Bett kontrollieren. Sie wollte alles kontrollieren! Mein ganzes Leben. Und ich hatte mich ihr verkauft... jäh kam mir der Gedanke, dass ich das alles eigentlich nicht wollte, dass das alles falsch lief. Aber ich hatte mich bereits zu abhängig von ihr als Kontrollfreak gemacht!
„Du, Steffi...", begann ich eines Tages rumzudrucksen.
„Jaaaaa?"
Sie wirkte plötzlich erwartungsvoll. Mit was für einer Frage sie wohl gerechnet hatte? Mich fröstelte auf einmal.
„Ich... ich habe mir gedacht... ich geh zum Lernen mal für drei Wochen nach Hamburg zu meinen Eltern. Da... da habe ich meine absolute Ruhe und bin nicht so hibbelig..."
Ein unangenehmer Wesenszug von Stefanie war, dass sie schon von Berufs wegen komplexe Zusammenhänge sofort durchschaute und sich nicht einfach aufs Kreuz legen ließ. Sie sah mich kurz hart an und ihre Unterlippe zuckte. Dann explodierte sie! Ich möchte hier gar nicht wiedergeben, was ich in den folgenden zehn Minuten an den Kopf geworfen bekam, obwohl ich zugeben muss, dass sie in vielen Punkten einfach recht hatte. Ich hatte viel zu lange die Situation mitgetragen, war ihr gegenüber nicht ehrlich gewesen. Im Nachhinein rechnete ich ihr hoch an, dass sie in den nächsten zehn Minuten die Trennung mit mir kühl, fast geschäftsmäßig, klarmachte. Sie hatte bei meinem Rumgedruckse sofort geschlussfolgert, dass es keine Zukunft für uns gab. Ich hätte dagegen mit dem Examensstress am Hals noch Wochen mit ihr rumgeeiert, wenn wir nicht den Schlussstrich gezogen hätten, und das Ergebnis wäre am Ende dasselbe gewesen.
Dadurch, dass ich jetzt frei war, hatte sie sogar mit dazu beigetragen, dass ich mein Examen in Ruhe über die Bühne bringen konnte. Wochen später rief ich sie an, um mich dafür zu bedanken. Ich hatte erst gedacht, sie würde sofort auflegen oder mich anschreien, aber dann wurde es doch ein angenehmes Gespräch. Wir einigten uns sogar darauf, dass ich ihr fairnesshalber noch 1500 Euro überwies, da sie mich tatsächlich eine ganze Weile miet- und lebensmitteltechnisch ausgehalten hatte, und wir traten im Guten auseinander.
*
STORCHENZELL
Nach dem zweiten Staatsexamen zog ich in die tiefste Provinz nach Storchenzell unweit des Bodensees, wo ich eine Stelle als Assistenzarzt in der internistischen Abteilung des kleinen Kreisklinikums angeboten bekommen hatte. Eigentlich war es kein Umzug, sondern eher eine Flucht. Das Großstadtleben war mir zuwider geworden und ich hing in meinen unruhigen Träumen immer wieder Snoopy und Stefanie nach. Träumte häufig vom Hätte, hätte, hätte... eine wiederkehrende Leier ohne Sinn. Es war alles aus und vorbei.
„Und das hier ist unsere Endoskopie", klärte mich mein neuer Chefarzt Dr. Häberle bei der Führung durchs kleine Krankenhaus von Storchenzell auf.
Für die Dauer der Probezeit hatte ich ein Zimmer im Schwesternwohnheim gemietet und war an meinem ersten Tag als Assistenzarzt schon um 5:00 Uhr rastlos vor Nervosität aufgestanden. Die Oberärzte schienen nett zu sein und ich blickte mit Spannung meiner Arbeit auf der onkologischen Abteilung entgegen. Krebsbehandlung, nicht gerade die Lieblingsdisziplin vieler angehender Kollegen. Aber ich interessierte mich sehr für Schmerztherapie und Palliativmedizin, die Betreuung von Sterbenskranken, was wohl den entscheidenden Ausschlag für die Stellenzusage bedeutet hatte.
„Gleich sind wir auf der 7B, die 7A wird von Frau Dr. Martin betreut", fuhr mein neuer Chef fort und begleitete mich ins verglaste Stationszimmer, das den Mittelpunkt beider Stationen bildete.
Dort saß meine neue Kollegin über die Patientenmappe gebeugt und bereitete ihre Visite vor. Ich spürte ein unangenehmes Kribbeln im Nacken, als ihre zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Haare plötzlich einen grauen Rolli freigaben, der aus dem langen Arztkittel ragte.
„Guten Morgen, Frau Dr. Martin, da kann ich Ihnen gleich Ihren neuen Kollegen Dr. Karlmann", vorstellen, begrüßte Häberle sie.
Ihr Kopf fuhr herum.
„Karlmann?", echote sie mit matter Stimme und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an.
„Ähm... Hallo... du hier?", stotterte ich, und bot ihr nach einigen Schrecksekunden lasch meine rechte Hand an, die sie jedoch nicht ergriff.
Dr. Häberle runzelte die Stirn.
„Wir... wir kennen uns aus Berlin von der Uni", hakte Claire tonlos ein.
Der Schock stand ihr ins Gesicht geschrieben.
„Ach sooo! Na, das ist natürlich eine tolle Überraschung für Sie beide", freute sich unser Vorgesetzter in Unkenntnis der Vorgeschichte.
Dann wies er Claire an, mich in die Führung der Patientendokumentation einzuweisen und rauschte mit wehendem Kittel hinaus.
Claire und ich saßen am späten Nachmittag mit gebührendem Abstand nebeneinander im Stationszimmer und gingen die Patientendokumentationen durch, ohne uns direkt anzusehen. Der Tag war unangenehm verlaufen, und das war noch gelinde ausgedrückt. Meist war sie wortlos und mit gesenktem Blick vorausgeeilt, hatte stakkatohaft dies und das erklärt, nur um gleich wieder zu verschwinden. Die Anstellung in Storchenzell war mir schon jetzt gründlich verleidet und vielleicht sollte ich eher bald die Notbremse ziehen und die Zelte vorzeitig abbrechen.
„Jonas? Die Dosierung des Fentanyl-Pflasters bei Hrn. Trautmann! Kann die sooo stimmen?", riss sie mich mit abfälligem Blick aus meinen Grübeleien.
Ich bemerkte entnervt den Zahlendreher und dachte bei mir, dass die Patientensicherheit auf keinen Fall unter so einer Situation leiden durfte. Ich sah sie verstohlen von der Seite an. Sie hatte sich eigentlich kaum verändert, war vielleicht etwas kantiger im Gesicht geworden. Ihre Lippen waren jedoch schmal und ihre Mundwinkel schienen manchmal zu beben. Manchmal hatte ich den Eindruck, sie krümmte sich vor Schmerz in Anbetracht meiner Anwesenheit. Es gab eigentlich nur eine Möglichkeit, sonst konnte ich gleich morgen früh kündigen. Flucht nach vorn!
„Es tut mir leid!", sagte ich bestimmt in ihre Richtung.
Sie blickte nicht von ihrer Mappe auf.
„Es tut mir leid, Claire! Es war dumm von mir. Ich entschuldige mich. Und du weißt ganz genau weswegen", sagte ich etwas lauter.
Ihre Mundwinkel zuckten nervös und ihre Hände begannen zu zittern.
„Ja", presste sie zwischen den Zähnen hervor und stand abrupt auf.
„Morgen früh zeige ich dir als erstes, wie unser Ultraschallgerät bedient wird", rief sie bei ihrer Flucht aus dem Stationszimmer.
„Zwei sooo nette junge Ärzte", flötete die Patientin mit dem Gallengangskrebs, als mir Claire die Funktionen des Ultraschallgeräts zeigte. Heute gab sie sich ein wenig verbindlicher, wenn auch nicht freundlich. Ob wir am Ende doch noch ein passables Team abgeben würden? Die Patienten mochten sie, das war mir bereits bei der ersten Visite klargeworden. Sie hatte eine einfühlsame, herzliche Art, die ich ihr früher nicht zugetraut hätte. Zu der Entschuldigung von gestern Abend sagte sie nichts und beim Essen mied sie meine Nähe.
Nach vier Wochen fand ich mich ganz gut allein auf der Abteilung zurecht und meine Arbeit gab offensichtlich keinen Anlass zur Kritik. Dr. Häberle begegnete mir bei den Visiten jedenfalls immer freundlich, hakte nur bei Kleinigkeiten nach und schien zufrieden mit Claires und meiner Leistung.
„Sie machen das beide sehr, sehr gut. Die Patienten sind voll des Lobes über Ihre Arbeit", hatte er vorgestern uns gegenüber nach der Visite geäußert.
Ich lächelte erfreut, während Claire sauertöpfisch zu Boden blickte. Sie wirkte nicht glücklich über das Lob, das an uns beide gemeinsam adressiert war.
*
Nach der Verabschiedung einer altgedienten Stationsschwester an einem sonnigen Freitagnachmittag setzte ich mich mit meiner Sektflöte auf die Bank in einer ruhigen Ecke des Gartengeländes bei der Kantine und starrte in die Fontäne des kleinen Brunnens. Wo hatte mich mein Leben nur hingeführt? Hamburg. Berlin. Köln. Und jetzt ins beschauliche Storchenzell. Bei dem Gedanken an die wilde und aufgeladene Zeit mit Snoopy und Stefanie und ihren hehren Träumen begann ich zu frösteln. Und dann ausgerechnet Claire hier in der Provinz, die mich schon so lange in wirren Träumen als Nemesis verfolgt hatte. Sollte mir das irgendetwas sagen?
Ich nippte an meinem Sekt, sah auf das Grün der umliegenden Berge und dachte plötzlich, dass es trotzdem gut war, wie es jetzt war. Gemessen an den Schicksalen meiner Patienten, war es für mich doch ein guter Tag. Eine Bewegung neben mir riss mich aus meinen Gedanken.
„Ich habe mich halt noch nie zuvor so gedemütigt gefühlt, Jonas", sagte Claire, die sich auf leisen Sohlen zu mir gesellt hatte.
„Das weiß ich doch. Aber ich weiß nicht, was ich noch tun kann, außer mich zu entschuldigen. Ich möchte hier in der Klinik einfach gut mit dir klarkommen", sagte ich nach einer Weile.
„Du weißt nichts. Gar nichts!", entgegnete sie mit harschem Unterton, „aber die Entschuldigung nehme ich an", flüsterte sie.
Diesmal sprang sie wenigstens nicht gleich davon, sondern blieb neben mir sitzen und starrte ebenfalls auf die bewegte Wasseroberfläche der Brunnenschale.
„Vielleicht lässt du es mich irgendwann ja wissen", sagte ich leise zu ihr gewandt.
„Vielleicht", murmelte sie kaum hörbar.
Sie streckte mir plötzlich ihre schmale, weiße Hand entgegen. Ich drückte sie und sie war überhaupt nicht kalt wie eine Porzellanhand, sondern warm, fast heiß und schwitzig. Bevor wir aufstanden und wieder zu den anderen gesellten hatten wir uns sogar kurz verhalten angelächelt. Heute war tatsächlich ein guter Tag!
Als ich mich an diesem Abend erleichtert zu Bett legte, fühlte ich erst so richtig, wie sehr mich diese alte Angelegenheit, die andere als Randnotiz in ihrem Leben längst abgetan hätten, unterschwellig belastet hatte. Wie mich der entsetzte Gesichtsausdruck der Gäste verfolgte, obwohl ich damals sternhagelvoll war. Ich glitt nur langsam ins Reich des Schlafs, verfing mich bald in einer unruhigen Zwischenwelt. Claire, die mich in ihrem Arztkittel auf Station anlächelte, bis ihr Blick auf meine Kitteltasche fiel, in der statt des Stethoskops plötzlich die Neunschwänzige Katze steckte. Als sie sich umdrehte und wegrannte, verfolgte ich sie durch einen endlosen Gang, der plötzlich blind endete. Da es keinen Ausweg für sie gab, zog sie langsam ihren Kittel aus, kniete mit Blick zur Wand vor mir nieder und entblößte Rücken und Po, bereit, sich meinen kräftigen Hieben zu unterwerfen.
„Sag es mir!", herrschte ich sie an, während sich die Haut ihrer Kehrseite rötete.
Doch sie blieb stumm und ertrug die Schläge, bis ich diesseits des Traums fast ohne Hilfe meiner Hände auf meinen Bauch abspritzte.
Am nächsten Tag auf Station ging die gemeinsame Arbeit merklich leichter vonstatten. Ihre Miene hatte sich deutlich aufgehellt und ich hoffte inständig, dass sie keine Gedanken lesen konnte. Was sie sich wohl bei meinen nächtlichen Obsessionen denken würde? Ich bewunderte ihr Fachwissen bei Chemotherapien und sie zog mich überraschenderweise häufig zu Rate, wenn es um die Schmerztherapie ihrer Patienten ging, nachdem sie von mir erfahren hatte, dass ich in Köln mehrere Monate in einer renommierten Schmerzklinik gejobbt hatte, um mir etwas Kohle dazuzuverdienen.
„Na ja, Psychotherapie ist schon eine wichtige Stütze bei chronischen Schmerzen", entgegnete ich, als sie um einen Tipp bei einem Patienten bat, der über Medikamente, TENS, Neuraltherapie und schweineteuren komplementären Verfahren wirklich alles versucht hatte.