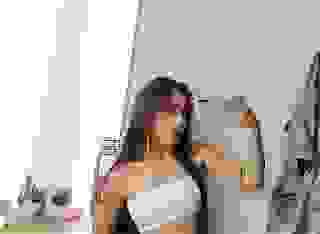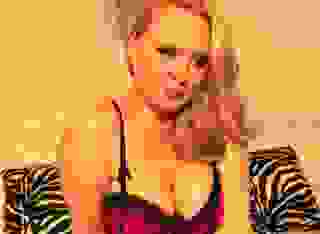Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hierDas beste und für uns Stammbesatzung wichtigste Versorgungsgut, dass U-510 an Bord hatte, waren Feldpostbriefe aus der Heimat. Ich gehörte zu den Glücklichen, denn die Post enthielt einen Brief meiner Eltern, der auf merkwürdige Weise aufmunternd neutral gehalten war. Meine Mutter notierte in einem Nebensatz, dass mein Vater alle Hände voll zu tun hatte, unsere auf Import und Export spezialisierte Handelsfirma am Laufen zu halten. Ich hatte klar verstanden; das Hauptgeschäft des Handelshauses Nordmann & Cie. war durch die Kriegseinwirkungen stark zurückgegangen,
Da mit U-532 ein zweites Boot unserer ‚eigenen' Flottille zeitgleich mit U-1062 in Penang einlief, brach für uns Stammbesatzung des Marinestützpunktes eine hektische Arbeitsphase mit mehr oder weniger geregelten zwölf- bis vierzehnstündigen Arbeitstagen an, die nur noch wenig Gelegenheiten für Privatleben ließen. So fiel ich an den meisten Abenden todmüde ins Bett, kuschelte mich in die Arme meiner beiden Mitschläferinnen, und schlief einen tiefen Erschöpfungsschlaf, ohne auch nur auf irgendwelche sexuellen Ideen zu kommen. Lian und Chen nahmen mir dies nicht übel und pflegten und umsorgten mich um so liebevoller. Ich hatte den Eindruck, dass sie erleichtert waren, den Ansturm von mehr als einhundertfünfzig sexhungrigen Marinesoldaten nicht mehr miterleben zu müssen.
U-510 hatte noch ein weiteres wichtiges Versorgungsgut an Bord: formale Beförderungsurkunden. Und so machte sich unser Standortkommandant daran, ein Reihe von eigentlich überfälligen Beförderungen unter der Stammbesatzung vorzunehmen. Ich wurde rückwirkend zum1. April zum Leutnant zur See ernannt. Neben neuen Schulterstücken und einer kleinen Gehaltserhöhung hatte diese Beförderung jedoch keine weitere Auswirkung sowohl auf unsere Arbeitsaufgaben als auch unsere Lebensbedingungen. Wir lebten ohnehin gut genug.
Unsere Hoffnung auf weiteren Nachschub aus der Heimat wurde jedoch enttäuscht. Dafür waren die Anforderungen und Wunschzettel der vier jetzt in unserem Hafenteil liegenden Boote unendlich lang und forderten unser gesamtes Netzwerk an japanischen Unterstützern sowie chinesischen und malaiischen Zulieferern zum Äußersten.
Um die Lebens- und Familienverhältnisse von Lian, Chen und ihren Familien ein klein wenig zu normalisieren, hatte ich den beiden Müttern einen Lieferantenpassierschein der deutschen Standortverwaltung ausgestellt, der sie auf dem Weg zu ihren Besuchen in unserer Villa vor aufdringlichen Überprüfungen der allgegenwärtigen japanischen Militärpolizei schützte. Auf diese Weise ergab sich nun die Möglichkeit zu einem wöchentlichen Familienbesuch, den alle vier Frauen mit Freude tagsüber wahrnahmen, wenn wir Offiziere unseren täglichen Aufgaben nachgingen. Lian und Chen wurden von den anderen Chinesinnen in unserem Haushalt ein wenig beneidet, waren diese doch nicht aus George Town, sondern irgendwo auf dem Festland beheimatet. Aber die beiden Mütter hatten ein feines Gespür für die emotionale Notlage der anderen Frauen und etablierten sich sehr schnell als die Mütter aller Frauen. Jedenfalls stellten wir drei Hausoffiziere jedes Mal bei unserer Rückkehr vom Dienst fest, dass die Stimmung aller Frauen spürbar fröhlicher und aufgeweckter war, wenn es tagsüber einen Besuch der Mütter gegeben hatte.
Ende Mai war weitgehend Ruhe auf unserem Marinestützpunkt eingekehrt. Die drei operativen U-Boote hatten erneut mit unterschiedlichen Einsatzgebieten und Zielen Penang verlassen, lediglich das Transport-U-Boot U-1062, dass uns die neuen Torpedos gebracht hatte, wurde von uns zum Transporter für kriegswichtige Rohmaterialien umgerüstet und sollte baldmöglichst wieder Richtung Heimat auslaufen. In dieser ruhigen Arbeitsatmosphäre, die nur einmal von einem kleinen britischen Bomberangriff auf den Hafen unterbrochen wurde, den die japanische Flugabwehr aber schnell unter Kontrolle brachte, sorgte dann die von unseren Alliierten weitergeleitete Meldung über die alliierte Landung in der Normandie für viel Gesprächsstoff unter den wenigen deutschen Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften an unserem Standort.
„Sieht so aus, als ob wir noch mehr auf uns und unsere japanischen Alliierten angewiesen sind", kommentierte Kapitänleutnant Grützmacher die Lage in unserer Dienstbesprechung Mitte Juni. „Jedenfalls haben der BdU und der deutsche Marineattaché in Tokio entschieden, dass mit Korvettenkapitän Wilhelm Dommes als ‚Chef im Südraum' ein neuer Oberkommandierender für alle deutschen Standorte in Südostasien seinen Dienst antreten wird. Er kommt in der nächsten Tagen nach Penang und wird hier sein Hauptquartier aufschlagen." Grützmacher zuckte mit seinen Schultern. „Immerhin ist der Fregattenkapitän vom Fach. Er hat damals als Kommandant das geschenkte U-Boot an die Japaner überführt."
„Heißt das, dass wir keinen Nachschub aus der Heimat mehr erwarten und nur noch auf uns selbst angewiesen sind?" Martin Haacks Frage war exakt auf den Punkt und sprach uns allen aus der Seele.
„Vorerst denke ich nein", antwortete Grützmacher. „Es sollen mehr als ein Dutzend Boote auf dem Weg zu uns sein, die alle im Frühjahr ausgelaufen sind. Wenn wir die üblichen 100 bis 120 Tage Reisezeit dazu rechnen, müssten diese Boote spätestens im Juli und August hier oder in Singapur und Batavia eintreffen. Dann könnten wir wieder unsere Läger mit Munition, Ersatzteilen und anderen Versorgungsgütern auffüllen und hätten eine stattliche Flottille zum Feindeinsatz."
„Wie sieht das eigentlich mit dem Kriegsverlauf im Pazifik aus?" fragte plötzlich der frischgebackene Oberleutnant Hageboom in die Runde. „Gibt es hierüber offizielle Informationen von japanischer Seite?"
„Wenig, die japanische Kommandantur hier hält sich sehr bedeckt. Aber ich nehme an, dass Fregattenkapitän Dommes eine Menge aktueller Informationen aus Tokio mitbringt. Das wird uns ein besseres Bild über unsere Lage vermitteln."
Genauso kam es. Der neu eingesetzte Chef der deutschen Streitkräfte in Südostasien erreichte Penang Ende Juni und stillte unseren Informationshunger mit einigen aktuellen Lagebeschreibungen. „Im Pazifik kämpfen Amerikaner und Japaner um jede Menge kleiner Inseln, ohne das dies einen wesentlichen Fortschritt für die feindlichen Einheiten erbringt. Japan konsolidiert seine Positionen, unsere Region auf dem südostasiatischen Festland als auch in der Inselwelt von Niederländisch-Indien und den Philippinen ist ungefährdet", lautete seine Lagebeschreibung."
„Haben Sie irgendwelche Informationen über die Situation in den U-Boot-Häfen in Frankreich?"
„Bisher haben die Landungsstreitkräfte in der Normandie einen Brückenkopf gebildet und werden von unseren Einheiten unter schweres Feuer genommen. Ich sehe derzeit keine Bedrohung für Lorient, St. Nazaire oder Bordeaux."
Dommes Aussagen wirkend überzeugend und beruhigend. Aber in unseren Tischgesprächen beim Abendessen war die Diskussion offener und skeptischer.
„Die Entwicklung in Europa macht mir echt Sorgen", fasste Martin Haack seine Eindrücke zusammen. „Bei allem, was man hört, befindet sich die Wehrmacht seit einem Jahr mehr oder weniger auf einem hart umkämpften Rückzug an praktisch allen Fronten."
„Den Eindruck habe ich auch", musste ich ihm zustimmen. „Aber in Italien sind die Amerikaner und ihre Verbündeten an der Gustav-Linie seit Monaten nicht voran gekommen. Da steht praktisch die Front. Dasselbe kann jetzt auch in Frankreich passieren, ohne dass es unsere U-Boot-Standorte bedroht." Ich war wirklich zuversichtlich, ohne zu ahnen, dass die Realität bereits dabei war, meine Einschätzung bereits zu überholen.
Ein merkwürdige Stimmung umgab das gesamte deutsche Offizierskorps in Penang. Praktisch unberührt von direkten Kriegseinwirkungen gingen wir unserem Dienst und unserem Privatleben fast wie in Friedenzeiten nach, während um uns herum die Welt und unsere Heimat in einem immer tödlicher werdenden Krieg versank. Aber wir waren uns unserer besonderen Situation kaum bewusst.
U-1062 war Mitte Juli endlich bis an den äußersten Rand der Ladefähigkeit mit kriegswichtigen Rohstoffen beladen und machte sich am 15.Juli mit nur einer Handvoll Torpedos als Bewaffnung auf den langen Heimweg nach Europa. „Mal sehen, was uns in Lorient erwartet", scherzte Oberleutnant Albrecht noch beim letzten gemeinsamen Offiziersfrühstück vor dem Auslaufen seines Bootes. Seine Skepsis sollte sich leider bewahrheiten. U-1062 kam nur bis zu den Kapverdischen Inseln, bevor es von einem amerikanischen Geleitzerstörer versenkt wurde. Damit ging auch mein einziger Feldpostbrief an meine Familie in Bremen verloren, so dass sie auch weiterhin nicht das geringste Lebenszeichen von mir bekamen.
Zunächst schlug die merkwürdige Stimmung unter uns Deutschen in Penang fast in Euphorie um als ab Mitte August in kurzen Abständen gleich vier U-Boote aus Frankreich, Kiel und Norwegen kommend in Penang eintrafen. Die beiden mit unseren japanischen Alliierten gemeinsam organisierten Begrüßungsfeiern arteten in jeglicher Hinsicht in Freudenorgien aus, gegen die unsere Begrüßungserfahrungen ein knappes Jahr zuvor noch geradezu gesittet gewesen waren. Immerhin waren die Boote teilweise fünf Monate unterwegs gewesen und waren mehrfach sowohl aus der Luft als auch zu See angegriffen worden.
Unsere euphorische Stimmung schlug aber wenige Tage später ins Gegenteil um. Der neue Chef aller deutschen Marineverbände in Südostasien rief Anfang September alle in Penang anwesenden Offiziere sowohl der Stammbesatzung als auch der im Hafen liegenden U-Boote zu einer Sonderdienstbesprechung zusammen. „Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass unsere so mühsam aufgebauten Flottenstützpunkte entlang der Biskaya-Küste für unsere Boote nicht mehr anlaufbar sind", waren seine ersten Worte. „Der Feind hat die Standorte wie Bordeaux entweder bereits erobert oder wie Lorient und St. Nazaire von Land und See her eingeschlossen." Korvettenkapitän Dommes bewertete diese Fakten zunächst nicht, machte dann aber zwei sehr klare Aussagen. „Dies bedeutet erstens, dass mögliche Nachschubwege für unsere Einheiten hier erheblich länger und schwieriger geworden sind. Und zweitens eine eigentlich wünschenswerte Rückkehr von Booten aus unseren Regionen, die dringend benötigte, kriegswichtige Rohstoffe in die Heimat schaffen sollen, ebenfalls deutlich komplizierter geworden sind." Er schaute stumm mit durchdringendem Blick in die kleine Runde der versammelten Offiziere, so als ob er bei jedem Einzelnen die Reaktion auf seine bedrückenden Mitteilungen überprüfen wollte. Dann ging ein sichtbarer Ruck durch ihn. „Wir haben einen klaren Auftrag und wir haben hierfür acht kampffähige Boote modernster Bauart. Wir führen in enger Abstimmung mit unsern japanischen Verbündeten den Seekrieg gegen Briten und Amerikaner in eigener Verantwortung fort."
Trotz seiner Motivationsbemühungen zur Hebung unserer Kampfmoral löste diese Dienstbesprechung bei jedem von uns nachhaltige Gedanken aus. „Wir haben jetzt keine Nabelschnur mehr", brachte Martin Haack seine Sichtweise auf den Punkt. „Wir können nur hoffen, dass unsere japanischen Alliierten uns als gleichwertigen Teil Ihrer Kriegsmarine akzeptieren und eingliedern. Ansonsten gehen wir schweren Zeiten entgegen."
Ich konnte mich seiner Sichtweise nur anschließen, war jedoch zuversichtlich, dass unsere unverändert überlegene U-Boot-Technik für die Japaner eine besondere Attraktion darstellte. Als ich aber abends mit meinen beiden Geliebten in unserem Bett lag, brachen meine Sorgen doch aus mir heraus und ich erzählte beiden von den Informationen des Tages. Lian und Chen hörten stumm zu, aber dann stellte Lian leise, aber mit deutlich hörbarer Besorgnis eine ganz entscheidende Frage:
„Was machst Du, was machen wir, wenn Deutschland seinen Krieg verliert, aber Japan unverändert über unsere Heimat herrscht? Hast Du darüber schon einmal nachgedacht?"
Ich blieb für einige Minuten stumm, während wir uns langsam streichelten; ganz unerotisch, eher mütterlich, fast wie uns gegenseitig zu beruhigen.
„Ich habe darüber, ehrlich gesagt, noch nicht nachgedacht. Bis zu der Besprechung heute Nachmittag schien mir ein Gedanke darüber überflüssig."
„Dann solltest Du jetzt anfangen, darüber nachzudenken", forderte mich Lian leise, aber sehr bestimmt auf. „Und wir denken mit Dir gemeinsam darüber nach. Es ist unser aller Leben und unsere gemeinsame Zukunft."
Die Nacht schlief ich zum ersten Mal seit langem sehr unruhig. Unser friedliches Idyll mitten im Krieg ging dem Ende zu. Lian und Chen wollten unter keinen Umständen in den Sklavendienst als Komfortdamen zurück. Und ich wollte unter genauso keinen Umständen in Kriegsgefangenschaft.
Auch in den nächsten Tagen war ich nur tagsüber mit viel Arbeit abgelenkt, hingegen abends und nachts sehr unruhig. Die Frage nach meines persönlichen Zukunftsaussichten wurde immer größer. Auch die Diskussionen mit meinen beiden Offizierskameraden trugen nicht zur Beruhigung bei, Oberleutnant Hageboom hatte bereits seinen Marschbefehl nach Singapur und wahrscheinlich anschließend nach Batavia bekommen, um sich dort um weitere Heimattransporte von kriegswichtigen Rohstoffen zu kümmern. „Die Japaner geben mir sogar eine freie Reise über Land nach Singapur", berichtete er, „Korvettenkapitän Dommes will nicht warten, bis unser nächstes U-Boot dorthin ausläuft." Es ging in der Tat sehr schnell. Mitte September verabschiedeten wir uns voneinander, dann ließ er seine chinesische Geliebte in der Obhut unseres Haushaltes zurück und verschwand auf Nimmerwiedersehen.
In der Tat beschlich mich Woche für Woche mehr das Gefühl, wir würden an unserem Marinestandort in Penang eine Art militärisches ‚Zehn kleine Negerlein' spielen. Zunächst verließen mit U-861 und U-862 Anfang November die letzten zwei in Penang beheimateten deutschen U-Boote den Hafen und verlegten ihren Standort nach Singapur und Batavia im vormaligen Niederländisch-Indien. Beide Boote nahmen zudem auf der kurzen Strecke einen Teil der deutschen Stammbesatzung zu den beiden anderen Einsatzstandorten mit, die gegenüber Penang den Vorteil hatten, Werft- und Trockendockkapazitäten zu besitzen. Kapitänleutnant Jürgen Oesten von U-861, mit dem ich mich während seiner Liegezeit in Penang näher angefreundet hatte, ging davon aus, dass er nach einer Werftüberholung voll beladen mit kriegswichtiger Ladung auf die Heimreise nach Europa gehen würde. So gab ich ihm überaus optimistisch zwei Tage vor seinem Auslaufen einen persönlichen Brief an meine Eltern mit.
„Ich hoffe, dass Sie meinen Eltern in Bremen dieses Lebenszeichen von mir übersenden können", kommentierte ich meinen Wunsch, als ich ihm den Brief übergab. „Ich vermute, dass ich als Hafenstandortoffizier mit meinen Sprachkenntnissen noch lange in Asien bleiben werde."
„Das sehe ich auch so", bestätigte der erfahrene U-Boot-Kommandant meine Einschätzung. „Unsere japanischen Alliierten haben hier in Südostasien eine sehr gefestigten Position, ich denke nicht, dass Sie in absehbarer Zeit es mit britischen oder amerikanischen Besuchern in Penang zu tun bekommen." Diese Einschätzung teilten wir alle. Zwar hatten wir wenige Tage zuvor gehört, dass es erste amerikanische Versuche zur Landung auf den Philippinen gab, aber das japanische Einflussgebiet in Ost- und Südostasien schien immer noch sehr gefestigt.
Mitte November war im deutschen Marinestützpunkt Penang eine ungeheure Ruhe eingekehrt. Korvettenkapitän Dommes hatte als Chef im Südraum neben mir und Martin Haack nur noch zwei weitere Offiziere in seinem Stab; diese aber bereiteten ebenfalls ihre Versetzung nach Singapur vor. Danach waren wir beide die ranghöchsten Offiziere in Penang und hatten noch vier Maate beziehungsweise Matrosen zu unserer Verfügung.
„Sie müssen den Standort in seiner Gesamtheit betriebsbereit halten", hatte Korvettenkapitän Dommes in seiner letzten Dienstbesprechung angeordnet. „Wir sind derzeit auf uns allein gestellt, aber ich bin zuversichtlich, dass wir neue Verstärkung aus der Heimat erhalten werden. Unsere japanischen Alliierten kämpfen vorbildlich und es ist unsere Pflicht, sie dabei mit allen Kräften zu unterstützen."
Dann ließ er uns mit unseren geringen Alltagsaufgaben und großer Langeweile zurück.
Weihnachten 1944 war das diametrale Gegenteil des Weihnachtsfestes ein Jahr zuvor. Martin und ich hatten unsere vier verbliebenen deutschen Soldaten zum Weihnachtsessen in unsere Villa eingeladen, des letzten noch bewohnten deutschen Offiziershauses in Penang. Unsere Köchin hatte mit unserer Organisations- und Beschaffungshilfe Peking-Ente mit reichhaltigen Zutaten zubereitet, ein Weihnachtsmenü, dass wir für viele Jahre in Erinnerung behalten sollten und dessen Qualität und Reichhaltigkeit sich für mehr als zehn Jahre nicht wiederholen sollte. Auch wenn die zahlreichen Chinesinnen in unserem Haushalt nichts mit dem Weihnachtsfest anfangen konnten, freuten sie sich in der Küche und ihren Räumen genauso an den reichhaltigen Gaumenfreuden.
Unser Tischgespräch kreiste recht freimütig um unsere Eindrücke von unserer derzeitigen Lage und den ungewissen Zukunftsaussichten für das kommende Jahr.
„Ich bin mir eigentlich nur über eine Tatsache sicher", philosophierte Martin Haack, „ich bin jetzt seit fast drei Jahren aus Deutschland fort und werde mit Sicherheit in den kommenden zwölf Monaten nicht in die Heimat zurückkehren."
Er hatte von uns sechs Marinesoldaten die längste Zeit in Penang verbracht, aber auch wir anderen fünf mussten uns seiner Einschätzung anschließen.
„Mit den spärlichen Informationen, die wir über die Lage in Europa haben, ist es vielleicht sogar ganz gut, dass wir hier unter japanischem Schutz fern der Heimat sind", sinnierte Obermaat Hinrichsen laut. Er kam aus Hamburg und hatte von irgendwoher aufgeschnappt, dass seine Heimatstadt nahezu vollständig von Bombenangriffen zerstört worden war. „Jedenfalls erzählte mir die zuletzt einlaufende Besatzung eine Menge Gruselgeschichten von einem Feuersturm und ähnlichen Ereignissen."
„Nur in Hamburg?" Ich merkte, dass ich von der Ereignissen in der Heimat sehr wenig wusste.
„Nein. Soll in vielen Großstädten so sein. Ein Maat von U-861 erzählte mir von einem Angriff auf Köln mit mehr als eintausend Bombern."
So trug am Weihnachtsessenstisch jeder ein wenig von seinen Informationsbrocken vor, die er in den letzten Monaten aufgeschnappt hatte. Aber diese Informationen waren teilweise ein halbes Jahr alt. Unsere Stimmung wurde deshalb nicht anheimelnder oder gemütlicher, im Gegenteil. Wir sprachen alle den reichhaltigen Bier- und Cognacvorräten zu, über die wir nun nahezu uneingeschränkt verfügen konnten, was eine allgemein melancholische Stimmung aufkommen ließ.
Spät am Abend traf ich mich dann mit Lian und Chen in unserem Schlafzimmer. Immerhin war ich noch nicht so volltrunken, dass ich ihnen beiden ein kleines, persönliches Weihnachtsgeschenk überreichte, was beide mit etwas ratlosen Gesichtern entgegennahmen. Die Halsketten mit den goldenen Anhängern hatte ich mühsam im Chinesenviertel von George Town anfertigen lassen, wobei ich im Tauschhandel mit Essensvorräten aus unserem Lager tatsächlich echte Goldschmiedearbeiten erwerben konnte.
Lian und Chen bedankten sich mit aller Liebe und Hingabe, ich war aber an diesem Abend zu keinen männlichen Leistungen mehr fähig.
„Was wird aus uns?" fragte plötzlich Lian, als wir aneinander gekuschelt in unserem Bett lagen. „Überlassen Martin und Du uns genauso unserem Schicksal wie Eure Kameraden mit deren Chinesinnen?"
„Müssen wir dann auch wieder den Japanern zu Diensten sein?" setzte Chen nach und holte tief Luft. „Eher bringe ich mich um als mich wieder dieser Sklavenhurerei auszusetzen."
Ich war mit einem Mal glockenwach. Hier in der merkwürdig friedlichen Ruhe der Weihnachtsnacht waren entscheidende Zukunftssorgen auf den Punkt gebracht worden.
„Nein!" antwortete ich entschlossen. „Ich bin mir sicher, das Martin und ich für Euch alle eine sichere Zukunft sichern können. Wir sind ja weiterhin hier", ich lachte leise auf, „ist ja noch nicht einmal mehr ein Boot da, mit dem wir auslaufen könnten."