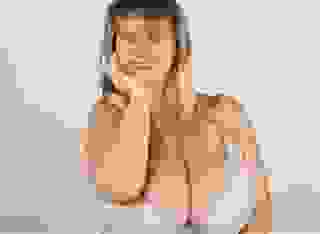Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hier»Ja, so bequem ist der Sessel nicht. Aber solche Sessel waren damals normal. Die Ohren dienten dazu, Zugluft abzuhalten, die es in den Gebäuden, in denen früher solche Büros waren, oft gab. Es gibt auch noch einen Kamin, aber der steht in Kisten verpackt irgend wo in einem Lagerraum«, dozierte Noira.
Mara nickte lediglich zu ihren Ausführungen. Zu Hause hatte sie ein eigenes Büro, in dem sie gelegentlich für Herrin Rebecca Papiere ordnete. Aber das war eher einfach und praktisch eingerichtet und überhaupt kein Vergleich zu diesem Raum hier. Selbst die Büros im Verwaltungsgebäude auf Horizons konnten mit diesem Raum nicht mithalten.
Noira wandte sich nun an Rebecca. »Also, was denkst du?«, fragte sie.
Rebecca trank einen Schluck und schien nachzudenken.
»Ich weiß einfach nicht«, sagte sie schließlich. »Erstens habe ich eine Arbeit, die mir Spaß macht und zweitens gibt es dann noch die Destille in Schottland. Und mein Projekt dort habe ich ja auch noch«, sagte sie.
Mara fragte sich, was sie für ein Projekt meinte.
»Und außerdem, ich lebe gerne auf Horizons. Ich mag die Leute und wir haben auch unsere Freunde dort. Das will ich auf keinen Fall aufgeben«, fuhr Rebecca fort.
Noira schaute sie kritisch an. »Selbst wenn du doppelt so viel Zeit hier aufwendest, wie ich es jetzt tue, dann hast du für all das noch genug Zeit. Na gut, eine geregelte Arbeitszeit als Designerin für Sexspielzeuge wirst du dann vermutlich nicht mehr haben, aber ich denke, auch das sollte sich in den Griff bekommen lassen. Aber vielleicht willst du das ja dann gar nicht mehr. Nötig hättest du es ja sowieso nicht, so wie ich es verstanden habe. Ich denke, du wärst in der Lage, die Firma wesentlich besser zu führen, als ich. Ich habe so etwas einfach nie gelernt. Aber du hast studiert. Und soweit ich weiß, gehört der kaufmännische Teil zum Studium dazu.«
»Und wie soll ich das bitte machen? Eine Woche Schottland, eine Woche auf Horizons, eine Woche hier und die vierte Woche wieder auf Horizons? Hast du eine Ahnung, wie viele Kilometer da zusammen kommen?«, fragte Rebecca.
»Wo ist denn das Problem? Ich glaube nicht, daß du es dir nicht leisten kannst, dir ein Flugzeug zu kaufen. Dann sperrst du eben einen Teil des Parkplatzes einfach ab und hast einen Landeplatz. Und eine Wohnung sollte sich in der Stadt auch finden lassen. Ich kenne da einen Makler, der hat mir letztens ein wirklich tolles Penthouse gezeigt. Das wäre sicher was für euch. Und wenn du nicht selber fliegen willst, dann lass doch Mara den Pilotenschein machen. So schwer soll das nicht sein, habe ich mir sagen lassen.«
Mara horchte auf, schaute Noira entsetzt an und warf Rebecca einen fragenden Blick zu.
»Ja, machbar ist das ganz sicher«, sagte Rebecca, ohne auf Maras fragenden Blick einzugehen. »Aber ich würde da gerne noch mal drüber nachdenken. Und vor allem kann und will ich das nicht alleine entscheiden.« Nun schaute sie zu Mara und nickte ihr zu.
»Na gut. Es ist ja nicht so, daß das alles jetzt gleich entschieden werden muss. Ich habe alles so lange alleine hier verwaltet, da kommt es auf ein paar Monate auch nicht an. Ich bin schon froh, daß du dich endlich dazu entschlossen hast, her zu kommen«, sagte Noira.
»Es ist mir nicht leicht gefallen. Glaub mir. Aber ich denke wirklich, es war gut, daß ich es getan habe«, sagte Rebecca mit einem Anflug von Unbehagen in der Stimme. »Auch, wenn es weh tut, die Stelle wieder zu sehen.«
»Rebecca, denkst du denn, mir ist es leicht gefallen? Du bist nicht die Einzige, die jemanden verloren hat. James war dein Vater. Ich weiß, wie wichtig er dir immer war und ich weiß, daß du ihm immer näher gestanden hast als mir. Aber er war auch mein Mann. Ich habe ihn geliebt und mir fehlt er genauso wie dir. Vergiss das bitte nicht.«
Rebecca nickte. Anscheinend war alles, was zu sagen war, gesagt.
Wie hat dir die Firma gefallen?«, fragte Noira, an Mara gewandt und wechselte so das Thema.
Mara, die noch immer in dem riesigen Sessel saß, nickte bedächtig. »Es war interessant. Viele von den Maschinen habe ich zu Hause auch schon gesehen. Aber da wurde nicht so viel mit Eisen gemacht. Das Gießen fand ich toll. Aber das war ganz schön heiß.«
»Ja, das ist jedes Mal wieder faszinierend. Das wird noch genau so gemacht, wie vor 500 Jahren, auch wenn es für viele Zwecke jetzt ganz andere Werkstoffe gibt.«
»Warum hast du eigentlich nicht wieder geheiratet?«, fragte Rebecca ihre Mutter, nachdem sie die Firma verlassen und sich zu Fuß auf den Weg zurück zu Noiras Haus gemacht hatten, welches nur ein paar hundert Meter entfernt in einem Wohngebiet lag.
»Eine gute Frage.« Noira zuckte mit den Schultern »Natürlich fehlt es mir, jemandem nahe zu sein. Aber die ersten Jahre kam es mir einfach falsch vor und später habe ich mich daran gewöhnt, alleine zu sein. Und nur für den Spaß braucht man nicht gleich jemanden zu heiraten oder auch nur eine Beziehung anzufangen. Dazu gibt es ja die Sachen, die du entwirfst. Oder man geht abends in die Gegend hinter der Frauentormauer.«
Rebecca blieb mitten auf dem Gehweg stehen. »Mama, du?«, rief sie aus.
Nun lachte Noira laut los. »Was ist denn schon dabei? Das macht doch jeder mal. Oder willst du etwa behaupten, daß du noch nie in einem Bordell warst?«
»Nein, war ich noch nie«, sagte Rebecca.
»Trotzdem finde ich es doch sehr prüde, daß du dich so darüber aufregst. Was ist denn schon dabei?« Noira schaute Rebecca an und ging weiter.
»Du wahrscheinlich auch noch nicht?«, fragte sie Mara, als sie auf der selben Höhe war, wie diese.
Mara schüttelte lediglich verlegen den Kopf.
»Vielleicht sollten wir heute Abend einfach mal eines besuchen. Ich lade euch ein«, meinte Noira, als Rebecca wieder zu ihnen aufgeschlossen hatte.
Doch sowohl Rebecca, als auch Mara lehnten die Einladung ab.
Statt dessen lud sie alle ein, bei ihr zu Abend zu essen und sich noch etwas zu unterhalten. Ramona und Quinn wollten zwar lieber im Transporter bleiben, doch Noira bestand darauf daß sie, ohne ihre Ponykleidung, mit kamen. Zusammen mit Silke bereitete Mara dann schließlich das Abendessen zu und sie gingen erst kurz vor Mitternacht zurück in den Transporter wo sie übernachteten.
Am anderen Morgen holte Silke Brötchen und so frühstückten sie noch bei Noira, bevor sie sich auf den Heimweg machten.
- - -
»Aufstehen und die Hände in die markierten Kreise legen!« Der Befehl kam laut und deutlich aus dem Lautsprecher in der Decke.
Nur widerwillig stand sie auf und stellte sich so an die Wand, daß sich ihre Hände in den roten Kreisen befanden, gut einen Meter weit voneinander entfernt.
Sie hörte, wie die Tür entriegelt und geöffnet wurde. Die Schritte von zwei Paar schweren Stiefeln hallte durch den Raum und sie hörte, daß einer der Wärter sich an die Stelle in der Ecke stellte, an der er jeden Morgen stand.
»Heute ist dein großer Tag«, sagte der andere Wärter mit einem höhnischen Unterton, der Spott, aber auch so etwas wie Genugtuung verriet. Einen Moment lang überlegte sie, ob sie nicht einfach den Fuß heben und ihm zwischen die Beine treten sollte, doch sie ließ es bei der Überlegung, als er ihr die Ketten um die Knöchel legte, mit denen ihr nur kleine Schritte möglich waren.
»Eigentlich schade, daß du uns heute verlässt Linda. Ich hätte dir nur zu gerne gezeigt, wie es meiner Schwester gegangen ist, als sie in Marokko in einem Puff gelandet ist. Aber du weißt ja, man sieht sich immer zweimal im Leben, also sage ich nicht adieu, sondern auf Wiedersehen.« Er fasste ihren rechten Arm und befestigte die eiserne Handschelle über ihrem Ellenbogen. Sie nahm den linken Arm nach hinten und ließ sich ohne Widerstand auch die Schelle am anderen Arm befestigen. Nun waren ihre Arme hinter ihrem Rücken gefesselt und mit einer weiteren Kette mit der zwischen ihren Knöcheln verbunden. Sie nahm die Unterarme nach vorne und ließ sich auch die Handschellen mit der einen halben Meter langen Kette anlegen.
»Ich glaube nicht, daß ich lange genug bleiben würde«, sagte sie selbstsicher.
Der Wärter schob sie aus der Zelle heraus auf den Gang. »Es wäre für alle am besten, wenn man dich einfach in irgend ein tiefes Loch werfen und den Schlüssel wegwerfen würde. Aber leider gibt es für Strafgefangene ja sowas wie Rechte. Falls du dich erinnerst, das ist sowas, was die Frauen, die deinetwegen versklavt worden sind, nicht hatten. Aber vielleicht gibt es ja doch noch so etwas wie Gerechtigkeit.« Der Wärter schob sie durch die Schleuse mit den drei hintereinander liegenden Gittertüren hindurch, während der zweite Wärter ihnen mit etwas Abstand folgte. »Ich habe gehört, eine gewisse Natalya Koroljova freut sich schon darauf, daß du Serva wirst.«
»Darauf kann sie lange warten. Ich werde ein paar Jahre ins Gefängnis gehen und werde dann frei sein und ein ruhiges Leben führen«, gab Linda spöttisch zurück. Doch der Wärter ließ sich nicht provozieren, wie sie mit Bedauern feststellen musste.
Der Wärter schob sie in den Speisesaal, zu der Schlange der an der Ausgabe wartenden, anderen Gefangenen. »Platz da, hier kommt eine Gefangene mit der höchsten Sicherheitsstufe«, rief der andere Wärter, der seine Maschinenpistole ohne Unterbrechung auf sie gerichtet hatte. Sie hatte sich anfangs überlegt, wie schwer es wohl wäre, ihm die Waffe zu entreißen, doch diesen Plan gab sie schnell wieder auf. Erstens konnte sie mit einer solchen Waffe nicht umgehen und zweitens wusste sie, daß die Waffen DNA-Codiert waren. Vor jedem Schuss wurde eine winzige Menge Blut aus dem Finger entnommen, der den Auslöser betätigte und analysiert, bevor der Schuss ausgelöst werden konnte. Zwar waren es nur Gerüchte, aber sie ahnte, daß in diesen ein Funken Wahrheit steckte, daß jemand mit der falschen DNA nicht nur nicht mit der Waffe schießen konnte, sondern durch starke Elektroschocks und Nervenblocker außer Gefecht gesetzt wurde.
Die anderen Gefangenen hatten ihr Platz gemacht, so daß sie, ohne warten zu müssen, ihr Essen bekam. Der Mann hinter der Ausgabe schaufelte ihr lieblos Kartoffelpüree, eine klebrige, braune Sauce, Erbsen und Möhren und etwas, das aussah wie Fleisch auf das unterteilte Tablett. In ein weiteres Fach der Unterteilung gab er eine Kelle voll einer undefinierbaren, rosafarbenen Masse, die wohl so etwas wie Pudding oder Joghurt sein sollte und meistens nach Himbeer-, Kirsch- oder Erdbeeraroma und viel zu viel Zucker schmeckte. Wie üblich verteilte sich diese Nachspeise dabei über den Rest des Essens. Über das Essen, das man als Serva in den Schulen bekam, hatte sie in den letzten Monaten viel gehört. Die Einen sagten, daß es wesentlich besser als im Gefängnis war, die Anderen behaupteten, daß es an den Schulen Hundefutter und pürierte Restaurantabfälle zu essen gab. Die Wahrheit lag wohl irgendwo dazwischen.
Sie bekam noch eine Plastiktüte mit Orangensaft in die Hand gedrückt und wurde dann zu einem freien Platz an einem der großen Tische geführt.
Beim Essen störten die beiden Wärter kaum. Sie standen in einem Abstand von ziemlich genau drei Metern zu beiden Seiten schräg hinter ihr und beobachteten sie, mit den Waffen im Anschlag.
Auch als eine andere Gefangene sich neben sie setzte, machten die Wärter keine Anstalten, dazwischen zu gehen. Warum sollten sie auch. Im Notfall waren sie in der Lage, einen Menschen mit einem Kopfschuss unschädlich zu machen, bevor dieser überhaupt wusste, was mit ihm geschah oder ihn mit einem gezielten Schuss in Brust oder Rücken zu betäuben, wenn sie gut drauf waren. Sie vermutete aber, daß sie erst dann dazwischen gehen würden, wenn Gefahr bestand, daß jemand sie töten würde. Sollte jemand nur darauf aus sein, sie zu verprügeln, würden die Beiden wahrscheinlich erst einmal weg sehen und den Angreifer machen lassen. Und sollte sie selbst irgend etwas Dummes versuchen, würden sie wohl kaum zögern, sie zu erschießen.
»Hallo, Linda«, sagte die andere Gefangene, die bereits angefangen hatte, zu essen und gerade einen Schluck aus ihrem Plastikbeutel getrunken hatte.
»Oh, ich bin also so berühmt, daß du mich zu kennen scheinst. Und mit wem habe ich das Vergnügen?«, fragte sie.
»Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich werde in spätestens einer Woche aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden. Ich soll dir schöne Grüße von Natalya Koroljova ausrichten. Sie ist ein wenig ungehalten darüber, daß ihr Ehemann deinetwegen für die nächsten fünfundzwanzig Jahre in einem russischen Gefängnis sitzt. Aber sie freut sich schon brennend darauf, dich balde auf ihrem Anwesen begrüßen zu dürfen«, sagte die Frau mit einem ausgeprägten russischen Akzent.
Linda sah die Frau nun genauer an. Sie hatte kurzgeschorene, blonde Haare, ein kantiges Gesicht und eine schlecht verheilte Narbe, quer über dem linken Auge.
»Ich werde ganz bestimmt keine Serva werden«, sagte Linda, doch daß diese Frau überhaupt hier war und ihr drohen konnte, auch wenn dies ganz bestimmt nur eine leere Drohung war, machte ihr Angst. Sie würde ganz sicher nicht in die Schule gehen, um Serva zu werden. Wahrscheinlich würde der Richter ihr bei der Strafe, mit der sie selbst rechnete, nicht einmal die Wahl lassen.
»Davon bin ich überzeugt. Und ich bezweifele auch, daß sie es dir so leicht machen würde. Immerhin haben Serva Rechte.«
Linda starrte die Frau an und fragte sich, ob an dieser Drohung nicht doch etwas dran war. Sie versuchte, ruhig zu bleiben und wandte sich ihrem Essen zu.
Als sie aufgegessen hatte, stand sie auf und brachte das Tablett und ihr Besteck unter den wachsamen Augen ihrer beiden Wärter zurück zur Ausgabe. Dann wurde sie zum Hauptgebäude gebracht.
Hier musste sie das übliche Prozedere über sich ergehen lassen. Sie wurde abgetastet und mit einem Metalldetektor gescannt. Schließlich musste sie sich in den Körperscanner stellen und wurde wahrscheinlich von allen Seiten eingehend betrachtet. Der Scanner war in der Lage, einzelne Schichten auszublenden, Entweder nur die Kleidung oder sogar jede einzelne Schicht ihres Gewebes, bis nur noch Knochen und alles, was massiver als ein Kaugummi war, sichtbar blieben. Sie hatte einmal gesehen, wie das auf den Monitoren aussah und dabei war ihr schlecht geworden, so daß sie sich beinahe übergeben hätte.
Aber es war auch möglich, wirklich nur die Kleidung auszublenden. Und den Blicken der beiden Frauen hinter den Monitoren zufolge, taten sie dies gerade.
Wenn Natalya Koroljov sie wirklich in die Finger bekommen sollte, dann dürfte sowas aber vermutlich ihr geringstes Problem sein, denn diese würde ihr wohl kaum Kleidung zugestehen, fuhr ihr durch den Kopf.
Die beiden Frauen gaben ihr OK und die Wärter brachten sie in die Garage. Drei andere Wärter standen bereits dort und warteten auf sie. Nachdem einer der Drei auf einem Pad unterschrieben hatte, wurde sie von diesen in den Transporter gebracht, in dem sie an der Wand zum Führerhaus sitzend, angeschnallt und angekettet wurde.
Zwei der Wärter setzten sich ihr gegenüber in Sitze, die wesentlich bequemer aussahen, als ihrer und schnallten sich an. Dabei hatte jedoch immer einer den Beiden seine Waffe auf sie gerichtet.
Die Fahrt zum Gericht dauerte nur eine halbe Stunde und dort angekommen, wurde sie sofort in den Gerichtssaal geführt, in dem wie an allen Verhandlungstagen auch, alle Zuschauerbänke belegt waren.
Die Abschlussplädoyers hatten der Staatsanwalt, die Anwälte der Nebenkläger und auch ihr eigener Anwalt bereits vor einer Woche gehalten. Auch ihr eigenes Schlusswort hatte sie schon abgehalten. Die kurze Ansprache, in der sie sich bei ihren Opfern entschuldigte und noch einmal betont hatte, daß es ihr leid tat, war allerdings nicht so gut angekommen, wie sie sich das erhofft hatte. Heute würde der vorsitzende Richter das Urteil verkünden. Auf einen Freispruch durfte sie nicht hoffen, wie ihr Anwalt ihr erklärt hatte. Auch sie selbst glaubte nicht daran. Sie konnte nur noch darauf hoffen, nicht in das Hochsicherheitsgefängnis auf Litla Dinum geschickt zu werden. Dieses Gefängnis war ein Bunker, der in die Felsen der kleinsten der Färöer Inseln gegraben war und es hieß, daß die Insassen dort nur einmal in der Woche das Tageslicht zu sehen bekamen.
Doch mit ihrem Schicksal hatte sie sich bereits abgefunden. Sie wusste, daß sie viele Fehler gemacht hatte und daß sie es verdient hatte, ins Gefängnis zu kommen, doch dieses Gefängnis wollt sie auf keinen Fall näher kennenlernen.
Die Richter betraten den Saal und alle Anwesenden standen auf. Sie erhob sich mit ihren Ketten und wartete, bis die Richter sich gesetzt hatten. Dann setzte sie sich selbst.
»Linda Pawlak«, sagte der vorsitzende Richter. »Sie sind angeklagt, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben, die 2415 Fälle von Freiheitsberaubung begangen hat. Außerdem hat diese kriminelle Vereinigung 2415 Fälle von Menschenhandel zu verantworten, zudem 715 Fälle von schwerem Diebstahl und eine nicht näher benannte Anzahl von Körperverletzungen. Zudem haben Sie Richter bestochen und somit das gesamte Rechtssystem des europäischen Staatenbundes untergraben. Das Gericht hat Sie in allen Fällen für schuldig befunden.«
Ein Raunen ging durch die Reihen der Zuschauer.
»Haben Sie noch irgend etwas zu sagen, bevor ich das Strafmaß verkünde?«
Linda hob den Kopf, den sie bisher gesenkt hatte und schaute den Richter an. »Nein, Euer Ehren«, sagte sie. Jedes weitere Wort wäre hier sicher zu viel gewesen.
Der Richter sprach weiter: »Das Gericht ist zu der Überzeugung gekommen, daß Sie ohne Rücksicht 2415 Frauen entführt und als Sklavinnen verkauft haben. Was diesen Frauen weiter zugestoßen ist, möchte ich hier nicht noch einmal ausführen. Das war in den letzten Wochen oft genug Thema gewesen und muss hier nicht noch einmal wiederholt werden. Die Strafen, die dieses Gericht vergeben kann, sind unserer Meinung nach kaum angemessen für die Taten, die Sie und ihre Helfer begangen haben. Doch Sie als Hauptverantwortliche haben eine besonders große Schuld auf sich geladen. Daher werden Sie zu lebenslänglicher Haft im Hochsicherheitsgefängnis auf Litla Dinum verurteilt.
Sie können in frühestens zwanzig Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Nehmen Sie das Urteil an?«, fragte der Richter.
Sie schaute auf und suchte den Blick ihres Anwaltes. Dieser schüttelte nur leicht den Kopf.
Dann war es also jetz vorbei. Damit war ihr Leben ganz offiziell beendet. Die einzige Hoffnung, die sie nun noch hatte, war, daß sie in zwanzig Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen konnte. Dann würde sie 65 Jahre alt sein und was sollte sie dann noch machen können?
»Ja«, sagte sie leise und mit belegter Stimme.
»Damit ist die Verhandlung geschlossen. Alles Weitere können Sie in der Urteilsbegründung lesen, die Ihnen in Kürze zugestellt werden wird«, sagte der Richter und stand, zusammen mit den anderen Richtern auf.
Auch alle anderen Anwesenden erhoben sich und verließen den Gerichtssaal.
Die drei Wachen kamen zu ihr und brachten sie wieder in den Transporter. Wieder wurde sie angeschnallt und ihre Ketten wurden am Sitz mit Schlössern befestigt.
Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie schon gefahren waren. Mehrmals war sie eingeschlafen und ebenso oft wieder hochgeschreckt. Durch das kleine Fenster in der Tür konnte sie den Himmel sehen und gelegentlich Bäume oder entfernte Berge. Sie wusste, daß sie irgendwo in ein Flugzeug umsteigen würden, welches sie auf die Gefängnisinsel bringen würde. Doch gerade wurde es dunkel und sie sah in regelmäßigen Abständen Lampen vorbei ziehen. Anscheinend waren sie gerade in einem Tunnel.
Doch bevor sie diesen verließen, wurde der Transporter auf einmal langsamer und hielt an.
Die Tür wurde geöffnet und die beiden Wärter lösten ihre Ketten vom Sitz.
»Wo sind wir hier?«, fragte sie verwundert.
»Das wirst du noch früh genug sehen. Und jetzt halt lieber die Klappe«, sagte einer der Wärter. Der andere Wärter löste ihren Gurt und zog sie vom Sitz.