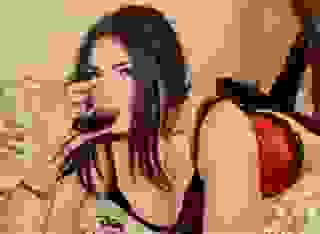Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hier„Zugegeben, es war nicht gerade einfach. Vor allem war's saukalt. In der Nacht minus dreißig Grad und der Wind heulte schrecklich laut."
„Hattest du Angst?"
„Ich hatte einen Sherpa als Guide. Er hat mich zu den besten Plätzen geführt, hat Spuren gelesen und ich habe mich bei ihm sehr sicher gefühlt. Aber trotzdem, ja, manchmal hatte ich Angst. Dennoch war es eines meiner schönsten Abenteuer bisher."
Sie saßen noch bis drei Uhr in der Früh am Tisch. Begeistert erzählte er ihr von seiner Reise. Er erzählte, wie er einmal unter der Höhenkrankheit gelitten hatte, weil er nicht auf seinen Sherpa gehört hatte und zu schnell aufgestiegen war. Er erzählte ihr, wie er mit einem uralten klapprigen Auto eine holprige Straße, die man in Mitteleuropa vermutlich nicht einmal Trampelpfad genannt hätte, zu einem Dorf hinauf gefahren war, um mit den Einheimischen über die Schneeleoparden zu sprechen. Er berichtete ihr, wie man ihn freundlich empfangen und mit Käse aus Yakmilch bewirtet hatte und wie die Dorfbewohner von ihren Erfahrungen mit dem Irbis berichtet hatten. Einer der Bauern hatte in einer Nacht die Hälfte seiner Schafe bei einem Angriff eines Schneeleoparden verloren. Ein großer Kater müsse es gewesen sein, denn er habe ihn gesehen, hatte er ihm berichtet. Mit großen, leuchtenden Augen habe der Kater ihn angestarrt und erst mit einem Schuss aus seinem Gewehr habe er das Tier vertreiben können. Dann habe er nur noch gesehen, wie der Irbis mit einem der Schafe im Maul in die Dunkelheit verschwunden war. Trotzdem hatte er überhaupt keinen Groll gegen die scheue Großkatze gehegt, denn seit einigen Jahren kämen immer wieder neugierige Touristen ins Dorf, nur um einen Irbis zu sehen und das ganze Dorf verdiene sich so ein nettes Zubrot, hatte der Bauer erzählt. So habe er sich nun auch ein paar Herdenschutzhunde kaufen können und seitdem habe er kein einziges Tier mehr an den Irbis verloren. Die Bevölkerung in Tibet hatte gelernt, mit dem Irbis zu leben und sah in ihm sogar durch den Tourismus eine Chance auf ein besseres Leben. Sein Sohn, so hatte der Bauer berichtet, könne inzwischen sogar eine Schule besuchen anstatt ihm bei der Arbeit zu helfen. Später wolle er studieren und dann ein Schneeleoparden-Ranger werden, der die seltenen Katzen schützt und die Besucher zu ihnen führt.
Schließlich gähnte Julia herzhaft.
„Langweile ich dich?", fragte Florian fast ein bisschen pikiert.
„Nein, ich bin nur ehrlich gesagt so langsam ziemlich müde."
„Dann heißt es jetzt wohl, uns Gute Nacht zu sagen?"
„Heißt es wohl", sagte Julia müde.
Eine Strähne war ihr wieder ins Gesicht gefallen und einen Augenblick lang spielte Florian mit dem Gedanken, sie ihr aus dem Gesicht zu streichen. Doch er traute sich nicht, stattdessen schaute er ihr einfach nur in ihre grünen Augen, die so faszinierend und doch so geheimnisvoll waren.
„Habe ich etwas im Gesicht?", fragte sie, als sie bemerkte, dass er sie anstarrte.
„Du bist wunderschön, weißt du das?", sagte er.
Julia schreckte zusammen. „Hör zu, das war wirklich ein angenehmer Abend. Bitte versau ihn jetzt nicht, okay?"
„Okay."
„Gut. Dann ... bis zum Frühstück."
„Ja", sagte er verlegen, „schlaf gut, Julia."
„Du auch."
Sie schnappte sich ihr Tablet und ging in Richtung der Quartiere und ließ Florian allein zurück. Sein Tee war inzwischen kalt geworden.
Kapitel 19: Größe Zweiundvierzig
Aufgeregt ging Annie Blackthorne am frühen Dienstagmorgen auf die Arbeit, als es gerade zu dämmern begann. Sie konnte es immer noch nicht fassen. Natürlich, die ganze Sache war wirklich schrecklich. Die arme Lydia Singer tat ihr furchtbar leid und irgendjemand hatte ein unverzeihliches Verbrechen begangen. Trotzdem freute Annie sich an diesem Tag darauf, zur Arbeit zu gehen. Sie war aufgekratzt wie ein Schulkind, das seinen ersten Schultag beging. Ihr erster Kriminalfall. Sie persönlich hatte die Leitung und das war die Gelegenheit, sich endlich bei ihren Vorgesetzten für höhere Aufgaben zu empfehlen. Sie hatte es satt, immer nur Taschendieben hinterher zu jagen und langweiligen Streifendienst zu verrichten.
Gleichzeitig mischte sich in die beschwingende Euphorie aber auch ein mulmiges Bauchgrummeln. Die leise Mahnung, dass sie wahrscheinlich nur diese eine Gelegenheit hatte, um denen da oben zu zeigen, was sie drauf hatte und dass sie diese besser nicht vermasseln sollte.
„Morgen", sagte sie am Empfangstresen zum Wachhabenden.
„Guten Morgen, Annie. Was hört man da? Du bist jetzt bei der Kripo?"
„Wer sagt das?"
„Der Flurfunk."
Annie kicherte. „Der übertreibt maßlos, Jimmy. Die Kripo ist mit dem Douglas-Mord beschäftigt, deshalb leiste ich nur ein wenig Amtshilfe."
Der Wachhabende antwortete: „Unsinn, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ehrlich, ich freu mich für dich. Das ist die Chance, denen in der Führungsetage mal zu zeigen, dass du richtig gut bist."
„Warten wir's mal ab. Ob ich wirklich so gut bin, werden wir erst noch sehen", sagte sie, unterschrieb ihre Anwesenheit und verschwand dann in der Umkleidekabine.
Nachdem sie sich ihre Dienstuniform angezogen hatte, ging sie in die Kaffeeküche und setzte einen starken Filterkaffee auf. Mit einem großen Becher in der Hand setzte sie sich an ihren Schreibtisch. Sie fuhr den Computer hoch und loggte sich mit ihren Zugangsdaten ins Intranet der Polizei ein. Der Startbildschirm brauchte eine Weile, um sich aufzubauen.
Während sie wartete, wurde ihr zum ersten Mal die Tragweite des Ganzen bewusst. Es ging nicht mehr um ein theoretisches Übungsszenario, wie sie zig verschiedene an der Polizeiakademie durchexerziert hatte. Das hier war die Realität. Ein echter Mensch war entführt worden, echte Angehörige hofften, bangten und standen Todesängste aus und verließen sich in diesem Moment allein auf sie, Annie Blackthorne. Eine kleine und unbedeutende Streifenpolizistin, die keine nennenswerten Erfahrungen in routinierter Ermittlungsarbeit hatte. Plötzlich fragte sie sich, ob sie dem Fall wirklich gewachsen war. War er nicht doch eine Nummer zu groß für sie? Sollte sie an der Tür ihres Chefs klopfen und ihn bitten, den Fall der Kriminalabteilung zu übergeben?
Sie fragte sich, ob Singer überhaupt noch lebte. Was mochten seine Entführer nur von ihm gewollt haben? Was war ihr Motiv?
Sie warf einen Blick ins E-Mailpostfach und stellte fest, dass die Spurensicherung noch keinen vorläufigen Bericht geschickt hatte. Weil sie noch keine heiße Spur zur Frage „Wer?" hatte, beschloss sie, erst einmal das „Warum?" anzugehen.
Waren die Entführer auf Geld aus? Sie musste die finanzielle Situation der Familie Singer durchleuchten. Als Universitätsprofessor verdiente man ganz bestimmt nicht schlecht, aber sie bezweifelte, dass man bei Singer viel Lösegeld erpressen konnte. Sie ging ihre Notizen durch, die sie sich aufgeschrieben hatte, als sie bei Lydia Singer daheim gewesen war und die Vermisstenanzeige aufgenommen hatte. Mrs Singer hatte viel von sich und ihrer Familie erzählt. Soweit Annie wusste, hatten alle ihre Kinder einen Universitätsabschluss gemacht, was sicher nicht ganz billig gewesen war. Was kostete ein Studium heute noch gleich? Und das Mal drei ...
Lucie, die jüngste, war neunundzwanzig und seit Kurzem in Sydney Assistenzärztin in der chirurgischen Abteilung eines großen Krankenhauses. Sie hatte Lucie an dem Abend selbst kennengelernt und auch deren Verlobten, einen Bankangestellten, der ebenfalls in Sydney wohnte.
Ihre ältere Schwester Phoebe, einunddreißig, war Anwältin für Steuer- und Finanzrecht in einer angesehenen Kanzlei in Brisbane und auf bestem Wege, Partnerin zu werden.
Der Älteste, Jackson, zweiunddreißig, war so etwas wie das schwarze Schaf in der Familie. Auch er hatte zwar studiert, Kunstgeschichte, genau wie sein Vater. Dann hatte er aber keine Lust auf eine akademische Karriere gehabt und sich sein gesamtes Erbe auszahlen lassen und sich eine Ranch mitten im Outback gekauft, wo er nun Rinder mit einigem Erfolg züchtete und ein paar riesige Felder sein eigen nennen konnte. Er lebte dort mit seinem Lebensgefährten und vor kurzem hatte das Paar ein Kind adoptiert, ein kleines Mädchen.
Lydia Singer, die Familienmatriarchin, hatte Innenarchitektur studiert und an der Universität eine Zeitlang unterrichtet. Sie und ihr Mann hatten sich daher auch an der Universität kennengelernt und sich ineinander verliebt. Seit die Kinder im Haus waren, hatte sie jedoch nicht mehr in ihrem Beruf gearbeitet und war ganz in der Rolle der liebenden und fürsorglichen Hausfrau und Mutter aufgegangen.
Alles in Allem eine typische Akademikerfamilie, die wahrscheinlich nicht am Hungertuch nagte, sich vermutlich mehr als einen teuren Urlaub im Jahr leisten konnte, aber auch nicht superreich war. Geld als Motiv der Entführer spielte wahrscheinlich keine Rolle, da war Annie sich ziemlich sicher. Sie machte sich trotzdem mit einem Klebezettel eine Notiz, sich bei der Bank der Singers nach der finanziellen Situation zu erkundigen und heftete sie an ihren Monitor.
Dann rief sie die Homepage der University of Brisbane auf, kämpfte sich durch mehrere Seiten und landete schließlich auf der Website des Instituts für Kunstgeschichte und rief die Seite mit den Mitarbeitern auf. Sie entdeckte Singer in einer Liste ganz oben, klickte einen Link an und schon erschien seine berufliche Vita, die sie sich als pdf-Datei herunterlud und in einen Ordner verschob, den sie „Singer_Recherche" nannte. Dann druckte sie sich Singers Vita aus und studierte sie. So viele Vorzüge das moderne Computerzeitalter auch haben mochte, ihr war richtiges Papier in der Hand immer noch am liebsten. Dann nahm sie sich einen Neonmarker und strich sich Stellen in Singers Lebenslauf an, die ihr interessant erschienen.
Singer hatte selbst in Brisbane studiert und mit einer Arbeit über den Spätimpressionismus promoviert. Anschließend waren in seiner Vita Postdoc-Aufenthalte in Deutschland am Museum der bildenden Künste Berlin, der Eremitage in Sankt Petersburg und sogar im Louvre, Paris, zu verzeichnen. Anschließend hatte er habilitiert mit einer Arbeit über den Einfluss indigener Steinmalereien der Aborigine auf die australische Alltagskultur und war schließlich an seiner alten Alma Mater auf den Lehrstuhl für Kunstgeschichte berufen worden. Sein Lebenslauf enthielt eine Liste mit seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen der vergangenen zehn Jahre, die recht lang zu sein schien. Aber Annie wusste nicht, wie viele Arbeiten ein Professor im Durchschnitt pro Jahr veröffentlichte und beschloss, diesen Punkt ebenfalls auf ihre Agenda zu setzen.
Sie fragte sich, ob seine Entführung mit seiner Arbeit zusammenhängen mochte. Hatte jemand vor, ihn zu ermorden, weil er auf seinen Professorenposten scharf war? Oder war es ein Racheakt eines Studenten, der sich von Singer ungerecht behandelt fühlte? Immer wieder hörte man, dass Professoren die Studenten und Doktoranden die Arbeit machen ließen und dann als Leiter der jeweiligen Arbeitsgruppe einfach ihren Namen unter die Überschrift eines Artikels setzten und dafür die Lorbeeren kassierten. Aber warum sollte sich dann jemand die Mühe machen, den Professor zu entführen? Warum hatte er - oder sie - Singer dann nicht einfach ermordet? Irgendetwas sagte Annie, dass der Professor dem Entführer nur lebendig nützlich war. Also doch eine Lösegelderpressung?
Annie seufzte laut auf. Sie drehte sich im Kreis. Ohne eine heiße Spur würde sie nicht weiter kommen. Und je mehr Zeit verstrich, umso schlechter waren die Chancen, den Professor lebend zu finden.
Eine Push-Nachricht kam herein und teilte Annie mit, dass sich eine neue E-Mail in ihrem Postfach befand. Die forensische Abteilung hatte ihr den vorläufigen Untersuchungsbericht der Spuren zugeschickt, welche die Spurensicherung aufgesammelt hatte.
Viel gab der Bericht zu Annies Entsetzen nicht her. Das Video aus der Kamera des Cafés gegenüber war nahezu unbrauchbar. Auch die Techniker hatten nichts an der schlechten Qualität ändern können. Die beiden Unbekannten ließen sich damit nicht identifizieren. Zwei Männer, der eine älter, der andere jünger, das war's. Immerhin hatte die KTU aber den Autotyp identifizieren können. Die Entführer hatten einen VW T 5.1 Transporter, Baujahr 2009 in der Farbe Weiß benutzt. Annie stöhnte. Bestimmt gab es hunderte Transporter dieses Typs auf den Straßen Brisbanes. Rechnete man die gesamten Vororte des Großraumes hinzu, waren es vermutlich tausende mögliche Wagen. Die Kennzeichen waren auf den Videoaufnahmen nicht erkennbar und würden ihr bei der Identifizierung des Wagens demnach keine Hilfe sein. Es konnte ewig dauern, bis sie alle zugelassenen Wagen in und um Brisbane überprüft hatte. Zeit, die sie nicht hatte. Zeit, die Singer nicht hatte.
Das Blut auf dem Teppich in Singers Büro stammte wahrscheinlich von Singer selbst. Die Blutgruppen stimmten überein, aber das Ergebnis einer Überprüfung des genetischen Fingerabdrucks stand noch aus. Also war der Professor verletzt. Die gute Nachricht war, dass es nur wenig Blut war, also lebte Singer wahrscheinlich noch. Der Bericht ging davon aus, dass die Blutspur eher nicht von einer Schusswunde herrührte, sondern am ehesten zu einer Platzwunde zu passen schien, wie man sie sich zuzog, wenn jemand mit einem harten Gegenstand zuschlug.
Jemand hatte vermutlich Singer mit einem kräftigen Schlag gegen den Kopf bewusstlos geschlagen und ihn dann in den Transporter geschleift. Die kleine Statue, mit der die Täter das Einschussloch in der Schreibtischplatte kaschiert hatten, war jedoch nicht die Tatwaffe, denn es gab keine Blutspuren darauf. Annie nahm deshalb an, dass die Täter am ehesten mit dem Pistolengriff zugeschlagen hatten.
Das Einschussloch war ebenfalls eine Sackgasse. Die Täter hatten das Projektil entfernt. Es war unmöglich zu sagen, welches Kaliber die Kugel hatte, geschweige denn, aus welcher Waffe es abgefeuert worden war.
Die Spurensicherung hatte zahlreiche Fingerabdrücke sichergestellt, von denen die meisten von Singer selbst stammten. Die restlichen konnten seiner Sekretärin zugeordnet werden.
Zuletzt listete der Bericht noch einen Abdruck eines Schuhs auf. Jemand musste in die Blutlache getreten sein und hatte einen deutlichen Abdruck hinterlassen. Der Bericht ordnete den Abdruck einem Turnschuh von Adidas zu, nicht das teuerste, aber auch nicht das günstigste Modell. Größe zweiundvierzig. Annie raufte sich genervt die Haare. Sicher liefen etliche tausend Personen in Brisbane mit genau diesen Schuhen durch die Gegend.
Enttäuscht stellte sie fest, dass sie nicht nur keine brauchbare Spur hatte, obendrein war auch ihr Kaffee zur Neige gegangen. Sie beschloss, sich frischen zu holen.
Die Kaffeemaschine zischte und gurgelte höhnisch, als wolle sie Annie auslachen. Während sie darauf wartete, dass der Filterkaffee durch die Maschine lief, wurde ihr zum ersten Mal bewusst, dass dieser Fall möglicherweise nicht die Chance war, die sie gewollt hatte. Womöglich hatte sie sich damit ihr eigenes Grab für ihre Karriere geschaufelt. Im Grunde konnte sie nichts dafür, dass es keine heiße Spur gab. Sie konnte ja schlecht eine Spur erfinden. Trotzdem würden es ihre Vorgesetzten, allen voran ihr Chef, so hinstellen, dass sie, Annie Blackthorne, keine Kompetenz hatte und sie auf Ewigkeit zum Telefondienst verdonnern.
Als sie sich gerade ihre Tasse vollgoss, kam Frank Goldstein um die Ecke. Goldstein war sechsundzwanzig, also gerade einmal ein Jahr älter als Annie, gutaussehend und der jüngste Detective Constable der Mordkommission, den das Revier je gesehen hatte. Mit anderen Worten: er hatte all das, was Annie sich wünschte. Doch sie gönnte ihm seinen Erfolg, denn er hatte hart dafür arbeiten müssen. Er hatte durch eine lebensgefährliche Undercoveraktion ordentlich Eindruck bei den Entscheidungsträgern der Chefetage hinterlassen und sich damit für den Dienst in der Kriminalabteilung empfohlen. Über viele Monate hinweg hatte er eine Gruppe rechtsextremer Gewalttäter mit Verbindungen zur Bikerszene unterwandert, deren erklärtes Ziel die völlige Auslöschung sämtlicher Aborigine des Landes war und die nicht nur Verbindungen zur amerikanischen Ultrarechten hatte, sondern auch zu Unterstützern des Nationalsozialistischen Untergrundes in Deutschland. Dank Goldsteins Einsatz hatte die ganze Zelle ausgehoben werden können. Wegen Planung mehrerer terroristischer Anschläge saßen sämtliche Mitglieder der Gruppe inzwischen in Haft und würden vermutlich nie wieder entlassen werden.
Vor allem aber stand Annie schon seit Ewigkeiten auf Goldstein. Bislang hatte Goldstein sie aber nie angesprochen und selbst traute sie sich nicht. Sie war ja schließlich nur eine einfache Streifenpolizistin und er ein Detective der Mordkommission. Und dann war da ja auch noch Annies Vorsatz, niemals etwas mit einem Kollegen anzufangen. Trotzdem, bei Frank Goldstein würde sie eine Ausnahme machen.
„Hey, Annie, hast du noch eine Tasse für mich übrig?", sagte Goldstein tonlos. An diesem Tag sah er ziemlich übermüdet aus. Tiefe Augenringe hatten sich unter seinen aquamarinblauen Augen gebildet. Ein dunkler Schatten von Bartstoppeln zierte sein Kinn. Der oberste Knopf seines Hemdes war geöffnet und er hatte den Knoten seiner Krawatte gelockert.
„Natürlich, hier", sagte Annie und goss Frank den Rest der Kanne ein.
„Danke", antwortete er mit einem müden Lächeln.
„Du siehst ziemlich fertig aus", stellte Annie mitleidig fest.
„Der Douglas-Fall hält uns ziemlich auf Trab. Wir alle schieben Doppelschichten und kriechen schon auf dem Zahnfleisch. Ohne Kaffee würde ich wahrscheinlich nicht überleben. Du bist deshalb meine Rettung, danke."
„Geschenkt. Habt ich denn inzwischen eine heiße Spur?", hakte sie nach.
„Nein", antwortete Goldstein lakonisch, „abgesehen von der Leiche, jeder Menge Blut und einem Schuhabdruck gibt es keine verwertbaren Spuren. Die Tatwaffe hat der Täter mitgehen lassen, wir haben sie nicht gefunden. Douglas' Sekretärin hat ausgesagt, er habe sich am Abend seines Todes mit einem Rechtsanwalt namens Thomas Renner treffen wollen. Es ging um irgendein Schließfach der Bank, irgendeine Erbsache. Einer von Renners Klienten hätte das Schließfach geerbt, aber den Schlüssel dazu verloren. Es gibt ein Schreiben auf Douglas' Schreibtisch, das sich auf dieses Schließfach bezieht, aber wir haben darauf weder DNA noch Fingerabdrücke gefunden."
„Irgendeine Ahnung, wen Douglas am Abend seines Todes getroffen hat?", fragte Annie neugierig nach.
Frank zuckte mit den Achseln. „Jedenfalls keinen Anwalt, so viel steht fest. Einen Anwalt mit dem Namen Thomas Renner gibt's jedenfalls nicht bei der Kanzlei, die im Briefkopf angegeben war. Und die ist auch auf Verkehrsrecht spezialisiert, hauptsächlich Fälle mit Blechschäden, ab und an mal was mit leichteren Personenschäden, alles nur Lappalien. Aber keine Erbrechtsfälle."
„Hm, dann ging es vermutlich um den Inhalt des Schließfachs?"
„Das vermuten wir auch."
„Was war denn darin?"
„Das weiß kein Mensch. Douglas hat den gesamten Inhalt des Schließfaches mitgenommen, um es Renner auszuhändigen. Am Tatort haben wir aber nichts gefunden, wir nehmen deshalb an, dass der Täter den Schließfachinhalt mitgenommen hat."
„Vielleicht war da irgendetwas Wertvolles drin? Schmuck oder ein Haufen Bargeld oder so etwas?", mutmaßte Annie.
„Kann gut sein. Wir wissen es wie gesagt nicht. In der Bank gibt es keine Aufzeichnungen darüber, was sich in den Schließfächern befindet. Im Grunde genommen könnte dort jeder alles lagern: Schmuck, Geld, Waffen, Drogen, ... such' dir was aus."
Frank trank von seinem Kaffee. „Na ja, wie man hört, hast du auch einen Fall an Land gezogen?"
Annie nickte. „Ja, eine Entführung. Eigentlich was für eure Abteilung. Aber da ihr alle so viel zu tun habt, soll ich euch entlasten."
„Und, kommst du voran?"
„Leider nicht. Ich werde wohl erst mal das familiäre Umfeld des Opfers checken. Vielleicht stoße ich auf etwas, das nach einem Entführungsmotiv aussieht."