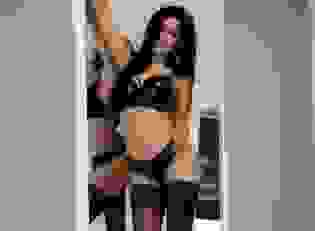- Romanze
- Eine Covid-20 Quarantäne
Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hierANMERKUNGEN DES AUTORS:
Ich beschäftige mich hier auch mit einem (leider) sehr aktuellen Thema. Lesern, die sich nicht unmittelbar mit der Realität auseinandersetzen wollen, sei von dieser Story abgeraten, ebenso all jenen, die Sex schon im ersten Absatz erwarten.
Den geduldigen Lesern dieser längeren Geschichte verspreche ich eine Menge Erotik und wünsche ihnen viel Spaß beim Lesen.
***************************
(1)
Irgendwann im Winter mutierte der verdammte Virus!
Während die ganze Welt auf einen Impfstoff hoffte, veränderte der kleine Teufel seine RNA und wurde noch wesentlich gefährlicher. Zuerst stiegen die Zahlen der in Krankenhäusern behandelten Patienten an, dann die Sterblichkeitsrate. In den Nachrichten wurde das erst mal ignoriert, Zahlen wurde verschönert oder verzerrt dargestellt, denn die einzelnen Staaten wollten alles andere als eine Panik. Als weltweit 4 von 100 Erkrankten an den Folgeerscheinungen der Krankheit verstarben gingen die ersten Virologen auf die Barrikaden und bei 8 Prozent war dann die Kacke richtig am Dampfen!
Irgendjemand nannte die Mutation nun Covid-20 und erklärte den neuen Namen mit der grundlegenden Veränderung der Erbinformation des Virus.
Ich war nie einer dieser Weltuntergangstheoretiker gewesen. Kein Bunker mit Lebensmitteln für einen Atomkrieg unter dem Haus, keine Wasseraufbereitungsanlage und kein dreifach abgesichertes Haus gegen Plünderer. Ich hatte zusammen mit zwei Freunden ein riesiges Jagdrevier in den Bergen gepachtet, auf dem sich auch eine kleine Hütte befand. Doch die Idee, sich im Notfall dorthin zurückzuziehen, war schon länger in unseren Köpfen herumgespukt. Sozusagen eine freiwillig auferlegte Quarantäne in der Natur, weit abseits der ansteckenden Menschenmassen. Wir alberten ein paar Mal darüber, wie fein es doch wäre die Pandemie dort oben mit ein paar Bieren auszusitzen.
Es blieb immer nur bei der Theorie. Martin hatte Familie (und für zusätzliche drei Köpfe wäre dort oben ohnehin kein Platz gewesen) und war wie Christian berufstätig. Wenn ich selbst auch nur mehr fallweise -- als Konsulent für Grundierungsarbeiten im alpinen Raum -- einer bezahlten Arbeit nachging, so hatte ich während der vergangenen Monate nie einen triftigen Grund gesehen, mein Zuhause zu verlassen.
Dann stiegen die Todeszahlen weiter an.
Nach einer weiteren Woche verstarben 2 von 10 Infizierten und dann wurden es 4. Eines Tages erhielt ich die Nachricht, dass man Martin in eines der unzähligen Lazarette gebracht hatte und zwei Tage später war er tot.
Praktisch die ganze Welt befand sich bald ein einem strikten Lockdown. Der Großteil der Bevölkerung wagte sich ohnehin nicht mehr nach draußen und schon gar nicht unter andere Menschen. Die Idioten, die die Krankheit zuerst verharmlost oder ganz geleugnet hatten, sprachen jetzt von einer gezielten Aktion der „Mächtigen", um den Planeten zu beherrschen.
Christian -- er war alleinstehend wie ich -- setzte sich in den Kopf, nach Afrika zu gehen, weil dort die Infektionszahlen angeblich am niedrigsten waren. Irgendwann brachte er es tatsächlich zustande, ein Ticket und die Einreisebewilligung nach Südafrika zu bekommen. Ich telefonierte mit ihm bevor er den Flieger nach Johannesburg betrat, dann habe ich nie wieder etwas von ihm gehört.
Die Sterblichkeit ging weiter nach oben und kratzte bald an der 60 Prozent Marke. Selbst die lebensnotwendigen Wirtschaftsbereiche wurden heruntergefahren und bald öffneten die Supermärkte nur mehr an drei Tagen in der Woche und man musste sich vorher anmelden, um Lebensmittel einkaufen gehen zu dürfen.
Was ursprünglich als Gedankenspiel begonnen hatte, begann immer mehr zu einem konkreten Plan zu werden.
Ich hatte binnen weniger Tage Alles für ein paar Monate in den Bergen zusammen. Jede Menge Konserven und haltbare Grundnahrungsmittel, Treibstoff für das Stromaggregat, Toilette-Artikel, die notwenigsten Medikamente. Das ganze Zeug war in meiner Garage gelagert und der Pickup parkte seither davor, bereit dazu, jederzeit die Flucht aus der Stadt antreten zu können.
Doch der Lockdown galt auch für mich. Die Polizei patrouillierte auf den Straßen und überprüfte mehr oder weniger lückenlos jede Person, die sie im Freien antraf, auf den Grund ihres Aufenthalts außerhalb der eigenen vier Wände.
Dann kam auch das Militär dazu! Wer hätte sich noch vor zwei Jahren vorstellen können, grün lackierte Schützenfahrzeuge und Panzer in unseren Städten aufmarschieren zu sehen? Diese Bilder kannte man doch bestenfalls von Berichten aus fernen Diktaturen.
Die Menschheit musste sehr rasch feststellen, dass trotz aller Automatisierung, Elektronik und künstlicher Intelligenz fast jede wirtschaftliche Tätigkeit auch humane Arbeitskräfte notwendig machte. Und genau die begann langsam auszugehen! Von einem funktionierenden Gesundheitssystem konnte ohnehin nirgendwo mehr die Rede sein und die Bilder von Massengräbern gehörten längst zur Alltäglichkeit.
Doch diese Menschen fehlten im Wirtschaftsprozess, ebenso wie all jene, die sich einfach nicht mehr aus ihren Häusern wagten und es kam zu ersten Versorgungsengpässen. Keine fünf Wochen, nachdem man im Fernsehen zum ersten Mal von steigenden Todeszahlen gehört hatte, blieben immer mehr Regale wirklich leer und die ersten Tankstellen schlossen. Viele Gehälter und Löhne wurden nicht mehr ausgezahlt. Selbst jene, die über Ersparnisse verfügten, konnten oft nicht darauf zugreifen, weil Bankomaten und elektronische Kassen nicht mehr überall funktionierten. Die Typen, die sich im März 2020 noch um Toilettenpapier gestritten hatten, schlugen zuerst die Schaufenster ein und dann wenig später gegenseitig ihre Köpfe. Von überall hörte man Meldungen über Ausschreitungen. Nicht nur in den Städten, auch im ländlichen Raum wurden immer mehr Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Tabakläden geplündert.
Die Sterblichkeitsrate machte auch vor der Polizei und dem Militär nicht halt, und so konnte dem Mob immer weniger entgegengesetzt werden. Irgendwo in Tschechien kaperte ein Idiot einen von der Besatzung verlassenen Panzer. Seine Kenntnis reichte zwar nicht für die Bedienung der Bordkanone, aber mit dem montierten Maschinengewehr und ein paar hundert Schuss scharfer Munition richtete er ein verheerendes Blutbad an. Und in Belgien starben dutzende Plünderer bei der Explosion nach dem Versuch den Benzintank einer Tankstelle aufzubrechen.
Mir war klar, dass ich trotz der Ausgangssperre losmusste! Wer nicht an dem Virus verstarb oder schlichtweg verhungerte, der würde innerhalb der nächsten Wochen von Randalierern, selbsternannten „Weltrettern" oder Bürgerwehren getötet werden. Mehr als die Hälfte der Häuser in meiner Straße stand schon leer und erst vorgestern hatte ich eine Gruppe „neugieriger" Jugendlicher mit Atemschutzmasken und Schlagwerkzeugen nur über Androhung von Waffengewalt von meinem Pickup fernhalten können. Die Baikal MP43 mit je einer 12/70er Schrotpatrone in den beiden Läufen hatte sie schließlich von der Unterlegenheit ihrer Stahlrohre und Baseballschläger überzeugt.
Es war ein Dienstag, an dem ich den Wagen belud, Fenster und Türen meines Hauses soweit es mir möglich war mit Brettern vernagelte und bei einem finalen Rundgang noch einmal kontrollierte, ob etwas liegengeblieben war, das ich in der Abgeschiedenheit der Berge brauchen konnte.
Die Luft war feucht und kühl, dichte graue Wolken zogen über den Himmel. Unsere früher so lebendige Stadt sah aus wie ein Schlachtfeld. Wo früher die Kinder der Bewohner gespielt hatten, standen jetzt demolierte Autos. Wo man nur hinsah lagen Glasscherben herum, ein Haus war vor einer Woche niedergebrannt worden und seine verkohlte Ruine schimmerte in bizarrem Schwarz hinter aufgetürmtem Hausrat, den Bewohner noch irgendwie in Freie gerettet hatten.
Ich spannte eine Plane über die Ladefläche und warf noch einen wehmütigen Blick auf mein Heim. Ich hatte seit der Scheidung vor über zwanzig Jahren in diesem Haus gewohnt und die Wahrscheinlichkeit, es irgendwann wieder in unversehrtem Zustand anzutreffen stand bei Null.
Niemand konnte sagen, wie sich der verdammte Virus weiter entwickeln würde. Doch Eines stand fest: Unsere Gesellschaft war genauso am Ende wie die Wirtschaft und es würde wohl nie wieder möglich sein, sie auf das bis vor kurzem noch scheinbar so sichere Niveau zu bringen.
Meine Lebensmittelvorräte waren für mehrere Monate berechnet. Außerdem lag mein Ziel an einem kleinen Bergsee voller Forellen und die Wälder rundherum strotzen vor Wild. Ich würde definitiv keinen Hunger leiden müssen. Auch wenn das Gebäude selbst nur für kurze Aufenthalte ausgelegt worden war und kaum irgendwelchen Komfort bot, so ließ es sich dort bestimmt für eine Zeit lang aushalten. Ich war ohnehin immer ein Mensch gewesen, der die Schönheit der Natur den Annehmlichkeiten der Zivilisation vorgezogen hatte.
Außerdem war jede Alternative besser, als hier tatenlos auf die weitere Zuspitzung der Situation zu warten!
Ich startete den Motor und fuhr langsam auf die Straße hinaus, beim Rollen über die Gehsteigkante sorgsam lauschend, ob meine umfangreiche Ladung auch richtig verzurrt an Ort und Stelle blieb.
Und dann sah ich den Polizeiwagen. Nicht mehr -- so wie noch vor wenigen Wochen üblich -- ein weißes Auto mit der entsprechenden Aufschrift und Blaulicht am Dach, sondern ein gepanzertes Fahrzeug, Gitter vor die Fenster geschweißt und die beiden Beamten darin sahen aus wie schwerbewaffnete, unter Schutzanzügen versteckte Mitglieder eines Sondereinsatzkommandos.
Sie hielten zwei Häuser weiter bei den Hermanns und stiegen aus. Ihnen folgte eine Frau mit langem, dunkelbraunem Haar und einer der schwarzen Atemschutzmasken im Gesicht, die nur bei Polizei und Heer Verwendung fanden. Neugierig, wer denn hier etwas am Haus dieses eng befreundeten Ehepaares zu tun hatte, wandte ich den Kopf und hoffte gleichzeitig, die Beamten wären beschäftigt genug, um nicht auf mich aufmerksam zu werden.
Doch einer der beiden Polizisten drehte sich in meine Richtung, lief um sein Fahrzeug herum und streckte prompt die rote Kelle heraus.
Keine zwanzig Meter unterwegs und schon die erste Kontrolle!
Ich ließ das Fenster hinunter
„Wo soll es hingehen?" fragte mich der Polizist. „Papiere und Legitimation für ihren Aufenthalt im Freien!"
Seine Stimme klang durch gedämpft durch die Schutzmaske und die Atemzüge in dem Filter hörten sich an wie jene von Darth Vader aus den alten Star Wars Filmen.
Ich hatte meine Erlaubnis gefälscht. Ein simpler Ausdruck aus einem Textverarbeitungsprogramm und der Stempel der Behörde war von anderen Papieren eingescannt und hinzugefügt worden.
„Gute Fahrt!" meinte der Beamte und bewies damit, dass er sich kaum für eine ernsthafte Kontrolle interessierte. „Geben sie auf sich acht!"
Immer noch neugierig fuhr ich nicht sofort los, sondern betrachtete den zweiten Polizisten und die langhaarige Frau.
„Kennen sie die Dame?" fragte mich Darth Vader. „Sie behauptet, hier zu wohnen!"
Sie hatte jetzt die Maske abgenommen und meine Augen weiteten sich vor Verblüffung.
Anna-Maria Hermann, die Tochter des Ehepaares, das dieses Haus bewohnte. Ich kannte das Mädchen praktisch seit ihrer Geburt. Obwohl ich erst vor knapp einem Jahr bei der Feier zu ihrem Abitur dabei gewesen war, versetzte mich der Anblick in Erstaunen. Ich hatte sie als Baby im Arm gehalten, war ab dem Kindergartenalter mit ihr im Garten herumgetollt, hatte Verstecken gespielt und ihr im Sommer Schlachten mit der Wasserpistole geliefert. In meinem geistigen Auge war sie immer noch das kleine, aufgeweckte Mädchen und nicht die erwachsene, junge Frau, die da jetzt vor mir stand. Ich rechnete schnell nach und stellte fest, dass sie knapp vor ihrem neunzehnten Geburtstag stehen musste.
„Ja, ich kenne sie!" murmelte ich, einmal mehr unter dem wehmütigen Eindruck, wie sehr die Zeiten sich geändert hatten.
„Danke! Dann ist alles in Ordnung!"
Die beiden Polizisten hatten es eilig wieder loszufahren und stiegen in ihren Wagen zurück.
Anna-Maria stand an der Türe ihres Elternhauses und läutete. Irgendwann ging ihr Blick nach hinten, sie erkannte mich und lief auf mich zu.
„Onkel Bert!" rief sie. „Schön dich zu sehen! Weißt du, ob meine Eltern zuhause sind?"
Immer noch bewegt von der Impression, was für eine hübsche, junge Frau aus dem quirligen, glutäugigen Mädchen geworden war, starrte ich sie an.
Ihren Vater hatte vor rund einer Woche der Leichenwagen abgeholt und ihre Mutter war zum Sterben in eines der Lazarette gebracht worden.
„Wo kommst du her?" fragte ich sie seufzend.
„Ich war bis vor einer Woche in Heidelberg auf der Uni!" erklärte sie und ich erinnerte mich daran, dass ihr Vater mir von dem Studium erzählt hatte. „Aber jetzt herrscht auch dort nur noch Chaos. Der Lehrbetrieb findet ohnehin schon länger nicht mehr statt und jetzt wurde auch das Studentenwohnheim besetzt. Ich habe drei Tage gebraucht, um hierher zu kommen und bin froh, dass ich es überhaupt irgendwie geschafft habe! Ich bin auf dem Bahnhof in die Polizeistation gegangen und die haben mich jetzt hergebracht!"
Anna-Maria sah entsprechend mitgenommen aus. Ihr Haar war unfrisiert, die Jeans schmutzig, der hellblaue Sweater am Rücken und den Ellbogen mehr grau, als noch in seiner Originalfarbe und die Sportschuhe schienen irgendwann einmal weiß gewesen zu sein. Dunkle Ringe unter ihren großen, braunen Augen zeugten von mangelndem Schlaf in den vergangenen Tagen.
„Weißt du, wo meine Eltern sind?" fragte sie nochmals und läutete. „Sie müssten doch zuhause sein! Es ist eine Schande, dass nicht einmal mehr die Handys richtig funktionieren!"
Sie ballte die Hand zur Faust, hämmerte gegen die Türe und rief:
„Papa ..... Mama! Falls ihr Zuhause sein, öffnet bitte!"
Ich starrte sie an und überlegte, wie ich ihr die schreckliche Wahrheit beibringen sollte.
Anna-Maria war immer schon ein hübsches Kind gewesen. Das dunkle, dichte Haar war ihr geblieben und reichte -- wie schon im Vorschulalter - bis weit auf ihren Rücken herab. Sie war nicht besonders groß und zählte auch nicht zu den dürren Hungertürmen ihrer Generation, die knochige Gliedmaßen und eingefallene Gesichter auch noch als sexy empfanden. Die enge Jeans spannte sich an einem runden, kräftigen Hintern, der mit seinen einwandfreien Kurven alles bot, was Weiblichkeit ausmachte.
Immer noch konnte ich nicht richtig fassen, dass sie das Mädchen war, dem ich vor ein paar Jahren noch Nachhilfe in Mathematik und Englisch gegeben hatte. Und immer noch stand ich vor dem Dilemma, ihr vom Tod der Eltern berichten zu müssen.
„Weißt du, wo sie sind? Ich habe keinen Schlüssel und kann nicht ewig hier auf der Straße bleiben!"
Aus einiger Entfernung war das Splittern von Glas zu hören und Menschen schrien laut herum.
Die Tränen stauten sich in Erwartung der schrecklichen Nachricht schon in Anna-Marias großen, wundervollen Augen. Sie dominierten ihr hübsches Antlitz, und gaben mit dunklen Braunen, seidigen Wimpern und ovalen Zügen das geradezu klassisches Bild eines attraktiven Gesichtes ab. Ihr Nasenrücken zeigte seit der Kindheit einen ganz leichten Knick, doch ich fand geraden diese winzigen Makel als ganz besonders hinreißend. Ich konnte mir gut vorstellen, wie viele Studenten in Heidelberg ihr hinterhergelaufen waren.
„Deine Eltern sind vor ein paar Tagen gestorben!"
Sie schluchzte herzzerreißend und warf sich mir in die Arme. In diesem Moment zählte kein Abstandhalten, keine Angst vor einer Infektion, es gab nur Verzweiflung und Trauer.
Anna-Marias Rücken bebte, sie heulte an meiner Schulter und holte dabei immer wieder geräuschvoll Luft. Jetzt war sie wieder wie das kleine Mädchen, das sich im Garten das Knie aufgeschlagen hatte und weinend auf mich zulief.
„Ich gehe weg von hier!" sagte ich kurzentschlossen. „Und ich nehme dich mit!"
Ich konnte sie nicht alleine hier zurücklassen! Das hätte ihr Todesurteil bedeutet! Offenbar besaß sie nicht einmal einen Schlüssel, um ihr das Haus ihrer Eltern zu kommen. Ich schob sie sanft von mir, zog die Plane über der Ladefläche hoch und holte den großen Vorschlaghammer hervor.
Sie heulte immer noch, als ich zuschlug. Die einbruchssichere Türe hielt zwar Stand, doch der Türstock splitterte wie weiches Balsaholz.
„Ich fahre zu einer einsamen Hütte in die Bergen. Da ist der einzige sichere Ort für die nächsten Monate! Geh rein, pack alles ein was du so brauchst, vor allem Medikamente, Toilette-Artikel und warme Kleidung! Du hast fünf Minuten!"
Sie zögerte, immer noch von Schock und Trauer gelähmt.
„Ich kann doch nicht einfach abhauen!"
„Anna-Maria, du musst mitkommen wenn du überleben willst! Sieh dich doch nur um! Hier ist es nicht mehr sicher!"
Sie verschwand schließlich doch im Haus und kehrte wenig später mit zwei gefüllten Sporttaschen und einem Rucksack zurück. Ein paar Tränen glänzten noch zu beiden Seiten ihrer Nase, als sie erstaunt die Fülle meiner Ladung erkannte, während ich ihr Gepäck zusätzlich unter die Plane pferchte.
„Das ist ja wie für einen Survival Trip!"
„Es ist kein Survival-Trip sondern unsere Lebensrettung!" erklärte ich. „Ich habe alles dabei, was in den nächsten Wochen dafür nötig ist. Lebensmittel, Treibstoff, Medikamente, Werkzeug und so weiter!"
Die .30-06 Springfield, die .375 Holland & Holland Magnum, die Baikal MP43 Schrotflinte und den 38er Special erwähnte ich nicht. Ich war kein Waffennarr, aber meine Jagdausrüstung würde in Zeiten wie diesen nicht nur die Versorgung mit Fleisch sicherstellen, sondern vielleicht auch nötigen Schutz bieten können.
„Wir können die Haustüre doch nicht einfach so offenlassen!" bemerkte Anna-Maria mit Blick auf den zerschmetterten Türrahmen.
„Steig ein! Ich fürchte, dass du das Haus in diesem Zustand ohnehin nicht mehr vorfinden wirst!"
Da begann sie wieder zu weinen.
(2)
Auf der Autobahn herrschte so gut wie kein Verkehr. Ab und zu standen Fahrzeuge am Pannenstreifen, die meisten mit eingeschlagenen Scheiben, bei vielen fehlten die Reifen.
„Sieh nicht hin!" sagte ich zu Anna-Maria, als wir uns einem Wrack nähern, bei dem ich schon von weitem die leblosen, grauen Körper auf den Vordersitzen erkennen konnte.
Sie hatte während der ganzen Zeit über kein Wort gesprochen und hockte mich angezogenen Beinen und um die Knie geschlungenen Armen auf dem Beifahrersitz, den Blick gedankenverloren aus dem Beifahrerfenster gerichtet. Ihr Gesicht war gerötet, Tränen liefen nach wie vor über ihre Wangen und ab und zu schluchzte sie leise.
Mir fehlten die Worte, um sie zu trösten. Ich wusste einfach nicht, was ich ihr sagen sollte, wie ich Beistand bei der Tatsache bieten konnte, dass ihre Eltern - genauso wie abertausende andere Menschen - nicht mehr am Leben waren.
Stattdessen begann ich die Menge der mitgenommenen Vorräte neu zu kalkulieren. Ich hatte die Menge der Lebensmittel für mich alleine ausgelegt und besonders Nudeln, Kartoffel und Mehl mussten jetzt für zwei Personen reichen. An Fleisch und Fisch würde kein Mangel bestehen, davon war ich überzeugt.
Je weiter wie in den Westen kamen umso mehr veränderten sich die schmutzig braunen Felder des Spätwinters in weiße Flächen. Hier lag noch ausreichend Schnee und bot einen Vorgeschmack auf das, was uns in knapp eintausendzweihundert Metern Seehöhe erwarten würde. Martin, Christian und ich hatten immer für einen ausreichenden Vorrat an Brennholz gesorgt, doch eine der allerersten Notwendigkeiten würde sein, diesbezüglich für Nachschub zu sorgen.
Nach einer weiteren Stunde Fahrzeit begann es schließlich zu schneien. Dicke, nasse Flocken segelten vom Himmel herab, überzuckerten die Fahrbahn und ließen die Reifen im Rückspiegel hässliche, braune Narben zurücklassen. Ich hatte Schneeketten dabei, denn ohne die würde es auch der Allradantrieb des Pickups nicht schaffen bis zur Hütte vorzudringen.
„Warum hast du mich mitgenommen?" fragte Anna-Maria mit leerer, tonloser Stimme. „Warum bist du erst jetzt gefahren?"